
Krim IV: Wem gehört die Krim?
(Red.) Wer immer auf der Krim war, wird gefragt, wie es denn den dortigen Tataren gehe, ob sie immer noch diskriminiert und vertrieben werden. Stefano di Lorenzo, der sich immer auch intensiv für die historischen Hintergründe einer aktuellen Situation interessiert, kommt zu einem anderen Schluss: Russland versucht die schwierigen Zeiten für die Tataren unter Stalin nicht unter den Teppich zu kehren, im Gegenteil. Hier sein vierter Bericht von seiner Erkundungsfahrt auf die Krim. (cm)
Viele Jahre lang lautete in der Ukraine die grundlegende Frage, um zu verstehen, wer auf der richtigen Seite und wer auf der Seite des Feindes steht: Wem gehört die Krim? Das war oft die erste Frage, die bei Interviews mit berühmten Persönlichkeiten gestellt wurde. Diese Frage konnte natürlich nur auf eine Weise beantwortet werden: Die Krim gehört zur Ukraine. Erst wenn man diese Frage richtig beantwortet hatte, konnte man anfangen, über andere Themen zu sprechen. Für viele in Europa war die Wiedervereinigung der Krim mit Russland im Laufe der Zeit aber zu etwas geworden, das man zumindest de facto noch akzeptieren konnte. Schließlich war es für die meisten offensichtlich, dass die Bewohner der Krim im Allgemeinen zufrieden mit der Wiedervereinigung mit Russland waren. Selbst in der Ukraine konnte man diese Realität nicht ganz verleugnen.
Dennoch war „der Raub der Krim“ eine Beleidigung, die die Ukraine in keiner Weise ertragen konnte. Für die Ukraine hatte der Krieg mit Russland bereits mit der pro-westlichen Revolution von 2014 und dem Übergang der Krim an Russland begonnen, obwohl dies praktisch ohne einen einzigen Schuss geschehen war, und nicht im Februar vor zwei Jahren. Die junge Nation hatte nach der pro-westlichen Revolution gerade ein starkes Gefühl des Nationalstolzes entdeckt, und dieser Stolz wurde nun brutal verletzt. Revolutionäre, das weiß man ja, sind keine Menschen, die dazu neigen, die Welt sehr nuanciert zu betrachten. Alles ist schwarz oder weiß, ein Mensch kann nur ein Held oder ein Verräter sein, zwischen Ruhm und ewiger Verdammnis liegt eine sehr dünne Linie.
Qırım
In Europa hingegen war nach dem Übergang der Krim (in der tatarischen Sprache „Qırım“) an Russland nur von den Krimtataren die Rede. Diese seien, nach Angaben der westlichen Presse und Politiker, Opfer ständiger und absolut willkürlicher Unterdrückung durch die russische Besatzungsmacht gewesen. Man redete ständig von einer tatarischen Krim. Als ob die Krimtataren — die ein anderes Volk sind als die Tataren in anderen Regionen Russlands — heute die ethnische Mehrheit und nicht nur 12 % der Bevölkerung ausmachten. Als ob die Tataren von jeglicher gesellschaftlichen und politischen Teilhabe auf der Krim ausgeschlossen worden wären. Als ob die Tage der Deportationen und Stalin plötzlich wieder da wären, als ob der Alptraum der Deportationen während des Zweiten Weltkriegs, als die Tataren der Kollaboration mit den Nazi-Besatzern beschuldigt wurden, noch immer präsent wäre. Man denke an das Lied der ukrainischen Sängerin tatarischer Abstammung Jamala mit dem Titel 1944, das den Eurovision-Wettbewerb 2016 gewann. Theoretisch sollte der Wettbewerb frei von politischen Themen sein, aber für die Ukraine und die Tataren konnte man offensichtlich eine Ausnahme machen, wenn das der Sache gegen Russland diente. Der Kalte Krieg, so sieht es aus, ist nie wirklich zu Ende gegangen, und dieser Kalte Krieg war neben vielen anderen Dingen auch ein Kulturkrieg. Und die Kultur, auch die Popkultur, ja gerade die Popkultur, kann auch eine Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln sein.
In den Jahren der Sowjetunion wurde nicht viel über die Deportation der Tataren und anderer Völker gesprochen. Heute, ganz im Gegenteil, bemüht sich Russland, diese Tragödie nicht zu verschweigen. Das ist am Beispiel an einer großen Gedenkstätte zu sehen, die in den letzten Jahren in der Nähe der ehemaligen Hauptstadt des Krimkhanats Bachtschyssaraj errichtet wurde, ein Bauwerk mit eindrucksvollen Skulpturen und einem Museum mit einer Dauerausstellung. Die Gedenkstätte wird auch häufig von Schulklassen besucht.

Die Tataren begannen in den späten 1980er Jahren auf die Krim zurückzukehren, als das sowjetische Regime mit der Glasnost und der Perestroika liberaler wurde. Im Jahr 1991 kam es dann zum Zusammenbruch der Sowjetunion und zur Unabhängigkeit der Ukraine. Während der ukrainischen Jahre erhielten viele Tataren, die in ihre historische Heimat zurückgekehrt waren, als Entschädigung Landstücke, oft am Rande der Städte. Auf diesen Grundstücken wurden dann oft Gebäude errichtet, ohne dass man sich um viele bürokratische Formalitäten kümmern musste. Für die Tataren, die nach einigen Generationen im Exil aus Zentralasien auf die Krim zurückgekehrt waren, war die Krim jahrhundertelang ihr Land gewesen und sie hatten daher ein „historisches Recht“.
Natürlich ist die Frage des historischen Rechts eine heikle Frage, denn in Europa, insbesondere in Osteuropa, aber nicht nur dort, haben sich die Grenzen im Laufe der Jahrhunderte so oft verschoben, dass die Wiederherstellung des historischen Rechts die Gefahr birgt, die Büchse der Pandora mit zerstörerischen Folgen zu öffnen. Der russische Präsident Putin selbst hatte in den ersten Jahren seiner Präsidentschaft argumentiert: „Durch den Zusammenbruch der UdSSR hat Russland Zehntausende seiner historischen Territorien verloren. Und was schlagen Sie vor — alles wieder aufzuteilen? Geben Sie uns die Krim zurück, einen Teil der Territorien anderer Republiken der ehemaligen Sowjetunion? Dann nehmen wir uns Klaipeda zurück. Lasst uns alles in Europa neu aufteilen. Wollt ihr das? Nein, ich denke nicht“, sagte er in einer Rede im Jahr 2005. Aber Politik ist nicht für die Ewigkeit bestimmt, Situationen und Bedingungen können sich ändern und je nach Problem und Lage passen sich die Entscheidungen der Politiker an. Wer in Deutschland zum Beispiel erinnert sich noch an Wahlslogans wie: „Keine Waffen in Kriegsgebieten“?
Griechen, Bulgaren, Italiener, Tataren, Ukrainer und Russen, all diese Völker sahen die Krim irgendwann in der Geschichte als die ihre und nur die ihre an. Also, zu wem gehört die Krim denn wirklich? Jeder hat seine eigenen Argumente, die allesamt historisch begründet sind. Mit den griechischen Siedlern trat die Krim in die Geschichte der zivilisierten Welt ein. Heute spricht man oft von den Tataren, als seien sie die einzigen wahren Herren der Krim, als sei die Krim schon immer ausschließlich tatarisch gewesen. Doch bevor die Tataren im 13. Jahrhundert kamen und nach der Auflösung des Krimkhanats im 18. Jahrhundert gab es viele andere Völker und eine lange Geschichte. Wenn wir eine langfristige makro-historische Perspektive einnehmen, kommen und verschwinden Staaten oft im Laufe der Jahrhunderte. Die Einwohner hingegen bleiben in der Regel bestehen. Das Krimkhanat ist nicht der erste Staat, der verschwunden ist, und die Tatsache, dass es einst so ruhmreich und mächtig war, dass es das Moskauer Fürstentum einige Male herausforderte, bedeutet nicht, dass es ein ewiges Recht auf diese Gebiete hatte. Schließlich hatten auch die Tataren diese Ländereien ihrerseits anderen, die vor ihnen auf der Krim gelebt hatten, weggenommen. Bereits im Jahr 1897, dem Jahr der Volkszählung im Russischen Reich, 126 Jahre nach der Übernahme der Krim durch das Russische Reich, waren die Russen die Mehrheit auf der Krim.
Mit ihrer Rückkehr gründeten die Krimtataren 1991 ein repräsentatives Gremium ihrer Gemeinschaft, den Medschlis. Die Medschlis-Versammlung wurde von allen in der Ukraine lebenden Tataren gewählt und hatte den Anspruch, die gesamte tatarische Gemeinschaft zu vertreten. In einem Spiel politischer Allianzen verbündete sich der Medschlis, der keine Partei war, zwischen 1991 und 2014 mit Politikern und Parteien, die dem pro-ukrainischen Populismus nahestanden und in der Regel auf der Krim nicht sehr populär waren. Bei den letzten ukrainischen Wahlen im Jahr 2010, an denen die Krim teilnahm, erhielt der künftige sogenannt „pro-russische“ Präsident Janukowitsch beispielsweise fast 80 % der Stimmen, während seine Hauptrivalin Julia Timoschenko nur 17,5 % der Stimmen bekam. Das tatarisch-ukrainische Bündnis war offensichtlich dadurch motiviert, dem dominierenden russischen Element etwas entgegenzusetzen. Allerdings mit bescheidenem Erfolg.
Nach dem Übergang der Krim an Russland erkannte der Medschlis das legitimierende Referendum nicht an. Vertreter des Medschlis gehörten sogar zu den Initiatoren der Blockade gegen die Krim seitens der Ukraine im Jahr 2015. Diese sollte die Krim zur Vernunft und zur „Heimkehr“ zurück zwingen. Schließlich wurde der Medschlis im Jahr 2016 als „extremistische Organisation“ für illegal erklärt. Die Zahl der Krimtataren, die die Halbinsel nach der Wiedervereinigung mit Russland in Richtung Ukraine verlassen haben, wird auf 10.000 bis 50.000 geschätzt, die Schätzungen gehen auseinander. Die gesamte tatarische Bevölkerung auf der Krim beträgt derzeit 250.000 Einwohner. Der Medschlis setzt seine Aktivitäten vom ukrainischen Territorium aus fort und betrachtet sich weiterhin als einziges Vertretungsorgan der tatarischen Gemeinschaft auf der Krim. Nach Ansicht von Kritikern hat der Medschlis den Bezug zur Lebenswirklichkeit der verbliebenen tatarischen Bevölkerung inzwischen jedoch verloren, auch angesichts der Schwierigkeit, durch eine Wahl eine wirksame Legitimation zu erlangen. Laut Kritikern soll heute der Medschlis allein durch den Wunsch nach Revanche motiviert sein.
Ein Beweis dafür, dass heute die Tataren Russland am Herzen liegen, ist die Tatsache, dass nach der Wiedervereinigung der Krim mit Russland in Simferopol mit dem Bau der größten Moschee der Krim begonnen wurde. In den Jahren der ukrainischen Verwaltung der Krim war die Moscheefrage oft politisiert worden, in einem ewigen Spiel von Versprechungen und Verzögerungen. Russland hingegen verschwendete keine Zeit und der Bau wurde bereits 2015 begonnen und ist nun praktisch fertiggestellt, es fehlen nur noch ein paar letzte Verfeinerungen. Während nationalistische, russozentrische und islamfeindliche Ansichten in der russischen Gesellschaft in letzter Zeit an Boden eher gewonnen haben, zeigt die russische Regierung oft ein gutes Verständnis dafür, dass Multikulturalität eine der Stärken Russlands ist und dafür gefördert werden muss.
Manche gehen, andere kommen
Wenn viele Menschen die Krim zwischen 2014 und 2022 verlassen haben, kamen auch viele Menschen aus der Ukraine auf die Krim, Leute, die auf der Krim Zuflucht vom Krieg suchten. Man spricht von etwa 50.000 Personen. Im Donbass wurde gekämpft und Städte wurden von den Ukrainern bombardiert, auf der Krim nicht, weshalb viele auf der Krim froh waren. Die russische Militäroperation auf der Krim, die dem Referendum im März 2014 vorausging, wurde zwar von internationalen Akteuren verurteilt, doch für viele Bewohner der Krim schien dies keine Rolle zu spielen. Was zählte, war, dass es mit der Operation gelungen war, Chaos und Krieg zu vermeiden und die Ordnung nach den Turbulenzen der Revolution, die die Ukraine erschüttert hatte, wiederherzustellen. Heute erinnert vor dem Krim-Rat ein Denkmal an die sogenannten „höfliche Menschen“, russische Soldaten, die nach dem Zusammenbruch des ukrainischen Staatsapparates im Februar 2014 die Kontrolle über das Krim-Parlament und strategische Objekte übernahmen, um für Ordnung zu sorgen.
Für die Ukraine hat die russische Militäroperation auf einem Gebiet, das sie als ihr rechtmäßiges Territorium ansieht, eine unheilbare Wunde hinterlassen. Die Ereignisse in Simferopol Ende Februar 2014, die zum sogenannten „Russischen Frühling“ führten, kamen nicht aus dem Nichts, sondern im Zusammenhang mit dem Sturz des ukrainischen Präsidenten Janukowitschs. Zuvor hatten mysteriöse Scharfschützen auf die Menge in Kiew geschossen — es gibt verschiedene Versionen darüber, wer sie waren, niemand hat es je ganz herausgefunden und niemand scheint wirklich daran interessiert zu sein, es herauszufinden. Einige beharrten darauf, dass es sich um russische Spezialeinheiten handelte. Andere wiederum sprachen nicht ohne Grund von einer gefährlichen Provokation durch die extremistischen nationalistischen Kräfte, die entschlossen waren, keinen Kompromiss mit Präsident Janukowitsch zu akzeptieren und die Revolution zu katalysieren. Das Massaker auf dem Maidan bleibt die Erbsünde der heiligen ukrainischen Revolution. Ein Rätsel, von dem man kaum hoffen kann, dass es irgendwann gelöst sein wird. Zu viel Zeit ist bereits vergangen.
Ukrainer auf der Krim heute
Die Krim hat drei Amtssprachen. Neben Russisch und Tatarisch gibt es auch Ukrainisch, obwohl Ukrainisch auf den Straßen in der Großstadt praktisch nicht zu hören ist. In Simferopol und anderen Städten der Krim sind einige ukrainische topografische Bezeichnungen erhalten geblieben, wie z. B. die Lesja-Ukrainka-Straße, benannt nach einer berühmten ukrainischen Dichterin des letzten Jahrhunderts. Oder der Park, der nach dem ukrainischen Nationaldichter Taras Schewtschenko benannt ist und in dem es auch ein ihm gewidmetes Denkmal gibt. Die russischen Behörden scheinen nicht sehr interessiert daran zu sein, das ukrainische Element auf der Krim zu canceln.
Es gibt auch eine „Gemeinschaft der Ukrainer auf der Krim“, eine offizielle Organisation, die seit 2020 tätig ist und eine Zeitung und eine Zeitschrift in ukrainischer Sprache herausgibt. Dies sind fast die einzigen Publikationen in ukrainischer Sprache, die heute auf der Krim erhältlich sind. Die Gemeinschaft der Ukrainer auf der Krim scheint aber in der Tat eine sehr pro-russische Organisation zu sein, die offen und leidenschaftlich die so genannte besondere Militäroperation unterstützt und das Z-Symbol, das russische Kriegssymbol, auf fast jeder Titelseite ihrer Zeitschrift abbildet. Auf die Frage, ob sich die Organisation mit dieser Art von Ansatz Leser und Sympathie bei den Ukrainern erhofft, antwortet die Gründerin der Gemeinschaft und Chefredakteurin der Zeitung „Krim-Bote“ Anastasia Gridchina, dass den Webstatistiken zufolge die meisten Leser ihrer Publikation in der Ukraine wohnen. Gibt es also viele ukrainischsprachige Ukrainer in der Ukraine, die für offenkundig prorussische Botschaften empfänglich sind? Vielleicht mehr, als man erwarten würde, wie auch einige Studenten der Universität von Simferopol versichern, die Verwandte in der Ukraine haben.
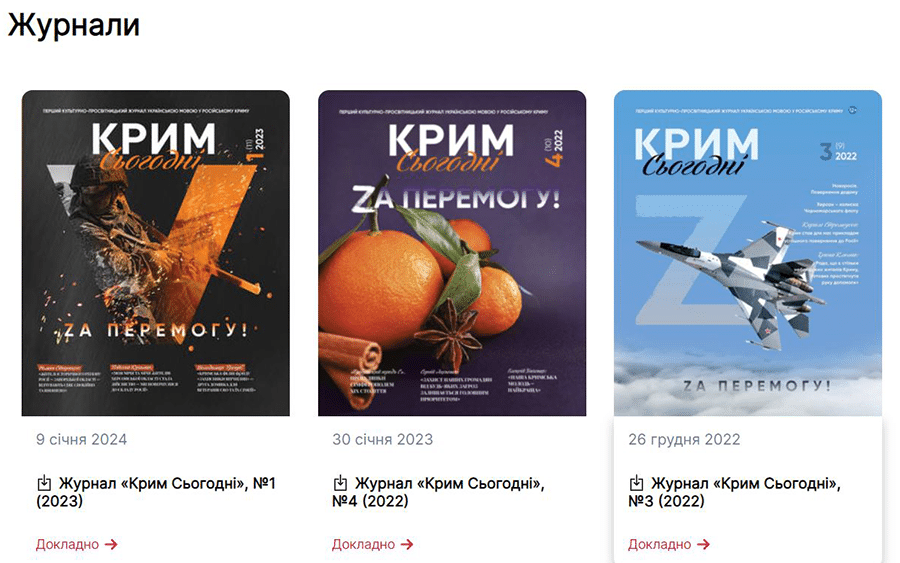
Auf jeden Fall scheint es, dass auf der Krim die sogenannten „dschduni“, die Wartenden, die auf das Eintreffen der ukrainischen Truppen zur „Befreiung“ der Halbinsel warten, keine sehr große Gruppe sind. In den Straßen von Simferopol oder anderen Krim- Städten war zum Beispiel kein einziges pro-ukrainisches Graffiti zu sehen. In Europa und Amerika ist der Name des ukrainischen Filmemachers Oleh Sentsow zu einem der Symbole des ukrainischen Widerstands auf der Krim geworden. Sentsow wurde 2015 in seiner Heimatstadt Simferopol wegen Terrorismus verhaftet und verurteilt. Er wurde danach befreit, heute soll er an der Front kämpfen. Doch die verschiedenen Sentsows verblassen im Vergleich zu der überwiegenden „schweigenden Mehrheit“ der Krim-Bewohner.
Siehe dazu von Stefano di Lorenzo: «Die Krim zehn Jahre danach», «Krim II: Kertsch – Antike, Widerstand und Brücken». «Krim III: Die Krim und die Geopolitik des Schwarzen Meeres»
Siehe zur Krim auch die Berichte von Christian Müller, der die Krim im Frühling 2019 persönlich besucht hat:
- den ersten Teil der Serie über die Krim (ein allgemeiner historischer und politischer Überblick)
- den zweiten Teil der Serie über die Krim (zu Sewastopol)
- den dritten Teil der Serie über die Krim (zu Kertsch mit den Katakomben und zur neuen Brücke auf das russische Festland)
- den vierten Teil der Serie über die Krim (über die vielen jungen Tataren, die die ihnen gebotene berufliche Chance packen)
- den fünften Teil der Serie über die Krim (über die Reisemöglichkeiten auf der Krim)
- den sechsten Teil der Serie über die Krim (zum Forum über die Verbreitung der russischen Sprache)
und den siebten Teil der Serie über die Krim (Persönliche Erfahrungen und Einschätzungen)



