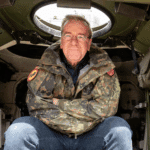Krieg gegen Russland? Das Schicksal von Iwan Nikolajew ist uns eine Mahnung!
(Red.) Iwan Nikolajew wurde am 26. Februar 1907 im Oblast Rostow in Russland geboren. Er starb am 6. Oktober 1988 um 9:55 Uhr in Samara. Er hat seine Einvernahme durch stalinistische Funktionäre zum Anlass genommen, sein Leben im Zweiten Weltkrieg – im Abwehrkampf der Sowjetunion gegen den Eroberungsfeldzug der deutschen Wehrmacht – zu beschreiben und auf Papier zu bringen, um diese Zeit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, was heute, 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wichtiger ist als je. René-Burkhard Zittlau hat diese seine Niederschrift für Globalbridge übersetzt, wofür wir ihm unendlich dankbar sind. (cm)
Ein kurzes Vorwort des Übersetzers René-Burkhard Zittlau
In wenigen Tagen jährt sich zum 80. Mal der Tag der Befreiung vom deutschen Faschismus. Ja, auch wenn von der Politik und den Medien alle Register der Manipulation gezogen werden: Wir wurden befreit von einer Last, von der wir uns nicht selbst zu befreien vermochten.
Die Stimmungslage in den einflussreichen Medien und insbesondere in der Politik erinnert jedoch eher an den Juni und Juli 1914 oder die Sommermonate des Jahres 1939, in denen die Massen auf jede erdenkliche Weise auf die Unvermeidlichkeit eines Krieges konditioniert wurden.
Ist auch jetzt wieder Vorkriegszeit?
Anfang des Jahres 2025 erreichte mich aus Russland der vorliegende Text, ein bisher nirgends veröffentlichtes Manuskript. Der Autor war mir völlig unbekannt. Ein Begleitbrief ließ mich aber wissen, dass es sich bei dem Text um einen Ausschnitt aus einem kleinen Buch handelt, in dem der Autor – der Großvater der Absenderin – rückblickend auf sein Leben Zeugnis über die Kriegsjahre vor sich selbst, seinen Nächsten und zugleich vor der Welt ablegt.
Im Juni 1941 eingezogen kehrte Iwan Nikolajew erst im Laufe des Jahres 1946 wieder zu seiner Frau und seinen Kindern zurück. In all der Zeit wusste die Familie nichts von seinem Verbleib.
Sein Leidensweg durch halb Europa beschreibt die unendlichen und systematischen Grausamkeiten, die ihm von Wehrmacht, SS, Gestapo angetan wurden und somit das, was das System des deutschen Faschismus und Nationalsozialismus für jene bedeutete, auf die es sich gierig stürzte.
Seine ruhigen, klaren Worte sind trotz allem zugleich eine Ode an das Leben.
Möge das Schicksal von Iwan Nikolajew Erinnerung und Mahnung in einem sein, insbesondere für Deutsche und Österreicher.
(Die Zwischenüberschriften habe ich als Übersetzer eingesetzt.)
Und so beginnt der Rückblick …
Wenn sie in den Ruhestand gehen, schreiben Staatsmänner und Politiker ihre Memoiren, damit diejenigen, die sie lesen, von ihren Irrtümern überzeugt werden. Es gibt nichts Falscheres als ein Geständnis vor der ganzen Nation. Die einfacheren Leute haben keine Gelegenheit, ihr Geständnis zu vervielfältigen, und schreiben deshalb keine Memoiren. Doch wenn schon jemand diese undankbare Arbeit auf sich nimmt, dann macht er das nur für sich selbst, neugierig darauf, wie seine Gedanken auf dem Papier aussehen werden, die jetzt niemandem mehr nützen.
Vom Schicksal zur Einsamkeit verdammt, ohne einen engen Freund, verspürt der Mensch im Alter ein gewisses körperliches Bedürfnis, mit sich selbst zu sprechen. Dieses Gespräch möchte ich in diesem Notizbuch festhalten.
Das, was wir heute tun, wird morgen zu gestern, und nur die Erinnerung verfolgt uns durch die Zeit. Das Gedächtnis ist unbarmherzig. Die angenehmen Dinge, an die wir uns gerne immer erinnern würden, verblassen wie ein Traum. Aber das Schlimmste, das Schwerste, das man ertragen musste, bleibt für immer in dir …
Acht Jahre nach dem Krieg
Einige Monate nach Stalins Tod 1953 erhielt ich die Aufforderung, mich beim Einberufungsbüro der Armee zu melden. Dort wartete man bereits auf mich. Ich wurde aufgefordert, in den hinteren Teil des Hofes zu gehen, wo ein „Wolga“ stand. Ich begriff, dass sie mich verhaftet hatten. In dem Büro, in das sie mich führten, saß ein Mann mittleren Alters in Zivil an einem Schreibtisch und etwas weiter auf einem Sofa saß ein Mann in den Sechzigern in Militäruniform. Der erste wies sich mir aus: Michailow, Ministerium für Staatssicherheit (MGB), Ermittler. Aus einer voluminösen Aktentasche holte er zwei dicke Ordner mit gehefteten Papieren heraus, bewaffnete sich mit einem leeren Blatt Papier und einem Füllfederhalter.
– Wie lautet Ihr Nachname, Vorname und Vatersname?
Ich sagte es ihm.
– Und wie war Ihr Familienname früher?
– Derselbe. Ich habe den Familiennamen nie geändert.
– Und Nikolajewskij hießen Sie nie?
Hier erinnerte ich mich, dass ich ihn schon einmal im Korridor des Bauunternehmens gesehen hatte, in dem ich arbeitete.
– Ich hatte schon vorher von Ihrer Institution keine hohe Meinung. Jetzt sehe ich, dass Sie noch schlimmer sind.
Michailow lehnte sich in seinem Stuhl zurück und schrie fast:
– Sie vergessen, wo Sie sind.
Noch im Wagen, als ich abgeführt wurde, dachte ich, dass man mich einschüchtern würde, dass man versuchen würde, in mir Schwäche und Feigheit zu wecken. Ich beschloss, meine Vermutung zu überprüfen.
– Nein, das vergesse ich nicht. Aber Ihnen steht es nicht zu, Ihre Stimme gegenüber einem Mann zu erheben, der einige Jahre in der Umarmung des Todes gelebt hat. Wenn ich hier zusammenbreche, können Sie mich nicht mehr aufrichten. Und Sie werden in Schwierigkeiten geraten. Außerdem, was können Sie mir schon antun? Ins Gefängnis stecken? Nun, das ist alles, was ich will. Aber dann verlange ich von Ihnen, dass Sie mir mindestens zehn Jahre garantieren. Auf eine kürzere Strafe lass ich mich nicht ein.
– Gut. Wir werden Ihre Bitte berücksichtigen, lächelte Michailow schief.
– Danke.
– Also, kommen wir zum Wesentlichen. Was habe ich Sie gefragt?
– Sie sagten Nikolajewskij, fahre ich fort. Die Sache ist die, dass ich, als ich 1946 in Kuibyschew (Samara) ankam, sofort in der Buchhaltungsabteilung des 11. Baubetriebs anfing zu arbeiten. Dort arbeitete auch ein siebzehnjähriges Mädchen, Ljuba Worobjewa. In den acht Jahren, die ich dort arbeitete, fiel mir nichts Besonderes an Ljuba auf. Ein temperamentvolles, etwas einfältiges Mädchen, das war’s. Aber in letzter Zeit hat sie sich plötzlich total verändert. Sie ist irgendwie sehr konzentriert geworden, sehr aufmerksam mir gegenüber. Sie folgt mir wie ein Schatten. Wenn ich mit jemandem spreche, hört sie mit offenem Mund zu. In meiner Abwesenheit wühlt sie in den Papieren auf meinem Schreibtisch. Dasselbe Schicksal ereilt die Innenseite meiner Jacke, wenn ich sie an der Stuhllehne hängen lasse. Es macht ihr übrigens nichts aus, dass andere Mitarbeiter sie dabei erwischen könnten.
Mir wurde klar, dass man mich gefunden hatte, aber noch nicht festnehmen wollte. Und Ljuba wurde benutzt, um mich im Auge zu behalten. Also beschloss ich, eine Komödie zu spielen. Einmal sagte ich in einem Gespräch mit ihr, im Leben der Dinge passiert alles Mögliche. Zum Beispiel hatte ich früher den Nachnamen Nikolajewskij … Nach diesem Gespräch kramte Ljuba einige Zeit lang in ihrer Schreibtischschublade. Nachdem sie das Büro verlassen hatte, schaute ich hinein und sah, dass auf dem Papier unter dem Puder und dem Make-up mit Bleistift „Nikolajewskij“ stand.
Michailow und sein älterer Genosse wechselten einen Blick. Ich fuhr fort.
– Es versteht sich von selbst, dass Ljuba Worobjewa Ihre Strafe nicht verdient hat. Sie hat Ihren Auftrag so gut wie möglich ausgeführt. Aber was denken Sie sich dabei, solch untalentierte Leute einzusetzen? Könnte es sein, dass nach diesem schrecklichen Krieg anständige Menschen sich weigern, Ihnen zu helfen, vor allem, wenn es um den Kampf gegen den Feind geht?
Sie schwiegen. Dann fragte der Ältere und deutete auf Michailow.
– Und wie haben Sie herausgefunden, wer er ist?
– Als Ljuba mir durch ihr Verhalten zu verstehen gab, dass ich beobachtet werde, dachte ich, dass ihr unmittelbarer Vorgesetzter mich auch beobachten will. Eines Tages sah ich ihn auf dem Korridor, erkannte ihn an seinen Augen. Ich ging auf ihn zu und sagte: „Diese Angelegenheit, wegen der Sie gekommen sind, muss jetzt zu Ende gebracht werden.“
– Was meinen Sie mit „an seinen Augen“?
– Es ist so. Eure jungen Tschekisten können den Leuten nicht in die Augen sehen. Es ist, als würden sie durch sie hindurchschießen. So ein Blick schmerzt mich hier im Hinterkopf. Am liebsten würde ich zu einer solchen Person auf der Straße gehen und eine Bemerkung machen.
– Nun ja … Man merkt, Sie haben viel Erfahrung.
– Sie brauchen nicht zu lachen. Wenn ich die Erfahrung gehabt hätte, wäre ich nicht dort gewesen …, wo ich war.
Der ältere Mann nahm sich eine Zigarette und begann zu rauchen. Michailow nahm das Verhör wieder auf.
– Also gut. Erzählen Sie.
– Was soll ich erzählen?
– Erzählen Sie uns von sich, seit vom Moment des Kriegsbeginns.
– Wie erzählen? Ich kann in einer Stunde alles erzählen, ich kann es auch in einem Monat.
– Kurz und bündig. Wenn nötig, fragen wir nach Details.
***
Die Zeit vor dem Krieg
Jetzt, in der Zeit des neunten Fünfjahresplans (1971-1975), ist es für einen jungen Menschen schwer, sich die Vorkriegszeit vorzustellen, die Zeit des Personenkults um Stalin, die Zeit des Generalverdachts und der Angst, die Menschen denunzierten sich gegenseitig, hatten Angst vor den Mauern, hatten Angst vor sich selbst. Man wurde zur GPU (Politische Abteilung der Verwaltung des sowjetischen Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten NKWD) vorgeladen und gezwungen, eine Erklärung zu unterschreiben, in der man sich verpflichtete, schriftlich zu berichten, was man gesehen und gehört hatte. Im Falle einer Weigerung bekam man den Stempel eines „Feindes des Sowjetsystems“ aufgedrückt. Es stimmt, auch ohne Unterschrift verlangten sie alle möglichen Informationen über Nachbarn und Kollegen. Ein unbedacht geäußertes Wort konnte durchaus der Grund für die Verhaftung einer Person sein. Dann wurde die verhaftete Person unter Anwendung von Folter verhört. Kein Familienmitglied durfte die verhaftete Person besuchen oder Nachrichten von ihr erhalten. Verurteilte, Verbannte oder Erschossene verschwanden gleichsam aus der Welt der Lebenden. Keiner der Angehörigen wusste, was mit dem „Repressierten“ geschehen war und ob er überhaupt noch lebte. Im Laufe mehrerer tragischer Jahre kamen viele Tausende führende sowjetische Politiker im Gewahrsam des NKWD (damals GPU) um. Insbesondere der Führungsstab der Armee. Der „Große Führer aller Zeiten und Völker“ Stalin konnte triumphieren. Er löschte alle aus, die ihm auch nur ein kleines bisschen als Rivalen in der politischen Führung der Partei und des Landes erschienen. Alle Massenmedien wurden in den Dienst des „Großen Führers“ gestellt. In dieser Zeit griffen Hitlers Horden unser Land an. Und „Generalissimus“ Stalin nahm die Verteidigung selbst in die Hand.
Wie sich später herausstellte, haben die Dienste Hitlers und des japanischen Militärs hart an der Erfindung von Unwahrheiten gearbeitet, um die bedeutendsten Militärkommandeure in den Augen Stalins zu kompromittieren. Das „Genie“ Stalin erwies sich dafür als fruchtbarer Boden. Tausende großartiger Söhne des Vaterlandes wurden später posthum rehabilitiert: die Marschälle und Generäle Blücher, Eidemann, Tuchatschewski, viele Weggefährten von Lenin ….
In diesen Jahren der Massaker wurden in jeder Stadt und in jeder Siedlung große und kleine Denkmäler für den „Führer und Lehrer“ errichtet. Am Ufer der Wolga, am Beginn des Wolga-Don-Kanals, wurde ein Denkmal errichtet, das über Dutzende von Kilometern sichtbar war. Nach Chruschtschows Zeugnis unterzeichnete Stalin selbst den Befehl, dreißig Tonnen des damals so knappen Kupfers für diesen Zweck freizugeben.
Nach seinem Tod wurde Stalins Leiche einbalsamiert und im Mausoleum neben Lenin beigesetzt.
Bald jedoch begann eine ernsthafte Untersuchung der unter Stalin begangenen Taten. Stalins Henker, Staatssicherheitsminister Beria, wurde verhaftet und dann als Agent des britischen Geheimdienstes erschossen. Aber diejenigen, die all die Jahre in der GPU ihr Unwesen getrieben hatten, blieben entweder in ihren Ämtern oder wurden auf andere Posten in Wirtschafts- oder Parteiorganen versetzt.
Nach dem Tod Stalins erinnerte man sich an die Verfassung, die Strafprozessordnung, an Gerichte und Juristen. Nach und nach begann man, die Ordnung wiederherzustellen und die Ermittlungsverfahren zu überprüfen. Diejenigen, die noch im Gefängnis und in der Verbannung lebten, wurden nach Hause entlassen, aus dem Strafregister gestrichen, am alten Arbeitsplatz für all die Jahre der Inhaftierung entlohnt und wieder in die Partei aufgenommen.
Die einbalsamierte Leiche Stalins wurde aus dem Mausoleum entfernt und in der Nähe der Kremlmauer beigesetzt, um damit zu unterstreichen, dass nicht alles an ihm tragisch für das
russische Volk war. Alle seine Denkmäler wurden zerstört, Bücher wurden aus den Bibliotheken entfernt. Aber die Erinnerung an ihn wird noch viele Jahre lang erhalten bleiben. Es ist schwierig, aus den veröffentlichten Dokumenten die bekannt gewordenen Fakten der Willkür der Vorkriegszeit herauszufiltern. Als die Verteidigung der Westgrenzen absichtlich geschwächt wurde, um Hitler unser Vertrauen in das Abkommen mit ihm zu beweisen. Es war Stalins „genialer“ Plan, Hitler zu zeigen, dass er von Osten nichts zu befürchten hatte. Im Ergebnis wurden die Armeen in der Ukraine und in Weißrussland in den ersten zwei Monaten des Krieges vollständig vernichtet. Der Feind stand vor den Mauern von Moskau und Leningrad. Und im Sommer 1942 unternahm Stalin eine grandiose Offensive im Süden, mit den Kräften der Kadereinheiten verschiedener Bezirke, mit den neu gebildeten, nicht ausgebildeten und schlecht ausgerüsteten Einheiten. Die vorrückenden Armeen erreichten mühelos den Raum Charkow, wo sie aufgehalten, umzingelt und vernichtet wurden. Danach stürmten die Deutschen nach Osten und erreichten Stalingrad (früher Zarizyn, heute Wolgograd).
Es brauchte also ein ganzes Kriegsjahr mit unkalkulierbaren Verlusten, bis der despotische Stalin begriff, dass es notwendig war, mehr mit den Plänen und Forderungen seiner am Leben gebliebenen Generäle zu arbeiten. Dem sowjetischen Volk mangelte es nicht an der Heimat ergebenen Menschen. Und das Volk fand die Kraft in sich, den Feind aufzuhalten.
***
Die ersten Kriegswochen
– Also, erzählen Sie.
– Es war in der Stadt Grosny. Ich arbeitete als Hauptbuchhalter in der regionalen Verwaltung von KOGIZ (Staatliche Vereinigung der Buch- und Zeitschriftenverlage). Die Einberufung zum Militär erhielt ich am zweiten Tag. Am dritten Tag trug ich bereits die Armeeuniform und ließ eine Frau mit zwei Kindern allein, die im siebten Monat mit dem dritten Kind schwanger war. Das 70. separate Bataillon der Versorgungsstation wurde aus Reservisten unterschiedlichen Alters gebildet, die größtenteils nicht ausgebildet waren. Wir wurden vierzehn Tage lang in Grosny trainiert. Ich persönlich hielt mich für recht gut vorbereitet und plauderte mit meinem Zugführer darüber, dass ich ein guter Schütze sei. Ich wurde einem Test unterzogen, die Kommandanten waren mit den Ergebnissen zufrieden und versprachen mir sogar ein Scharfschützengewehr.
– Wo haben Sie schießen gelernt? fragte Michailow.
– Während des Bürgerkriegs habe ich als elfjähriger Junge die Waffen von toten Rotgardisten und Offizieren der Weißen Armee aufgesammelt. So hatte ich zwei Lager mit Waffen. Das große Lager wurde von meiner Mutter entdeckt und sie meldete es dem Kommandeur der Roten Armee. Er zog die Waffen ein und schimpfte mich aus, weil ich sie nachlässig gelagert hatte. Das zweite Lager mit mehreren Gewehren und Patronen hatte ich bereits fachgerecht gelagert und über Jahre hinweg Schießen geübt. Später in Pjatigorsk wurde ich Sieger bei einem Schießwettbewerb.
Nach zwei Wochen in Grosny wurde unser 70. Bataillon an das rechte Ufer der Ukraine (Anm. des Übersetzers: gemeint ist das rechte Dnepr-Ufer) geschickt. Wir irrten lange umher, bis wir die uns zugewiesene Versorgungsstation fanden. Die Station hieß Uman.
Die Front kam auf uns entgegen; in der Nähe von Uman gerieten wir in einen Strom unserer Einheiten, die sich ungeordnet zurückzogen. Und nach dem ersten Gefecht war von unserem Bataillon nichts mehr übrig. Lange Tage mit unorganisierten Kämpfen zogen sich hin. Tagsüber umzingelten uns die Deutschen und zerschlugen uns, so dass wir gezwungen waren, uns in Sonnenblumenfeldern und den kleinen ukrainischen Wäldern zu verteilen. In der Stille der Nacht sickerte jeder, der konnte und so gut er konnte, nach Osten durch. Wann immer es möglich war, schlossen sich kleine und große Gruppen zusammen und setzten sich zur Wehr, aber die Deutschen griffen erneut an und es wiederholte sich schließlich dasselbe. Wir lebten von Viehfutter. Wir hatten keine Zeit zum Schlafen. Und irgendwo, ein paar Kilometer von Bachtanka entfernt, im Oblast Nikolajew, wurde ich gefangen genommen.
– Erzählen Sie davon genauer, bat Michailow.
– Sie liegen nicht weit von der Wahrheit, wenn Sie aufschreiben, dass ich selbst zu den Deutschen ging.
– Nun, trotzdem genauer …
– In der Nacht zuvor hatte ich mich mit einer Gruppe von Maschinengewehrschützen einer ziemlich großen Kampfeinheit angeschlossen, die sogar über zwei leichte Geschütze verfügte. Irgendwann gegen Mittag blockierten die Deutschen unseren Rückzug nach Osten. Einige der Soldaten nahmen eine Verteidigungsstellung ein, andere wandten sich nach Süden. Ich war in der Verteidigungsstellung. Wir hielten die Deutschen eine ganze Weile auf Distanz. Nach einer Weile begannen die Deutschen jedoch, uns aus der Luft anzugreifen. Bomben pfiffen. Dann gab es eine Explosion. Ich weiß nicht, was dann geschehen war. Ich weiß nicht, wie ich auf den Grund des Bombenkraters gelangte. Ob mich Kämpfer dorthin geschleppt hatten, weil sie ein Lebenszeichen fanden. Ich kroch aus dem Loch. Mein Kopf, mein Rücken und mein rechtes Bein schmerzten. Rundherum war es still, nur gelegentlicher Geschützdonner irgendwo weit im Süden war zu hören. Aufstehen konnte ich nicht. Ich begann mich umzusehen. Nicht weit entfernt sah ich zwei weitere durch Bomben verursachte Krater und in der Nähe die Leiche eines toten Soldaten. Weder mein Gewehr noch das Gewehr des Soldaten waren dort zu finden. Ich habe nicht danach gesucht, um zu schießen. Ich war zu schwach und betäubt, um daran zu denken. Ich brauchte etwas, auf das ich mich stützen konnte.
– Wie erklären Sie sich die Tatsache, dass Ihr Gewehr nicht da war, fragte Michailow.
– Unter dem Druck der Deutschen überquerten wir den Bug bei Wosnesensk, so gut wir konnten. Viele von uns haben ihre Gewehre im Fluss verloren. Auch ich. Aber am nächsten Tag hatte ich bereits wieder eine Waffe, da ich einem gefallenen Soldaten das Gewehr abnahm. Viele Kämpfer blieben jedoch ohne Waffen. Sie zogen trotzdem in den Kampf und verteidigten sich gemeinsam mit allen anderen. Die Waffen der Gefallenen wurden sofort von den Lebenden übernommen.
Die Sonne ging gerade unter. Ich war unerträglich durstig. Ich war bereit, mir die Hand abzunagen und Blut zu trinken. Ich kroch über die Hirse zum Mais. Ein kräftiger Maisstängel diente mir als Stock. Ich kam auf die Beine. Alles tat weh. Ich ging auf die Straße. In einem Kilometer Entfernung sah ich Telegrafenmasten und ein kleines Haus. Wie ich später herausfand, war es ein Bahnwärterhäuschen. Ich konnte nicht mehr klar denken. Anstatt bis zum Abend im Mais zu lauern, ging ich in Richtung des Häuschens. Ich lief lange, setzte mich hin. Die Sonne war schon untergegangen, aber als ich dieses Haus erreichte und mich an die Wand lehnte, war es noch hell. In diesem Moment kamen zwei deutsche Soldaten um die Ecke: automatische Waffen vor der Brust, die Hände hinter dem Rücken. Offensichtlich hatten sie mich schon seit längerer Zeit beobachtet. Alles in mir zitterte. Ich sank in der Nähe der Mauer auf den Boden. Doch nach einer Minute stand ich ohne jeden Befehl auf. An der Geste eines der Deutschen erkannte ich, dass ich kommen sollte. Unmittelbar hinter der Hütte stand ein gepanzerter Mannschaftstransportwagen. Ein paar Schritte entfernt war ein Brunnen, auf dessen Balken ein Eimer mit Wasser stand. Ich eilte zu ihm und begann gierig zu trinken. Dann riss ich mich gewaltsam von dieser Beschäftigung los.
In der Nähe des Hauses befand sich ein Vorgarten. Dort saßen und lagen etwa zwanzig gefangene sowjetische Soldaten. Mehrere waren verwundet, irgendwie mit blutigen Tüchern verbunden. Ein Offizier lag auf einem Mantel, kaum noch am Leben, blutüberströmt. Ich setzte mich am Zaun nieder.
Das war’s. Deshalb sage ich, dass es sich so darstellt, dass ich selbst zu den Deutschen gegangen bin.
– Ich verstehe, sagte Michailow. Fahren Sie fort.
– Die schlaflosen Nächte forderten ihren Tribut. Ich schlief ein. Am Morgen weckte mich einer der Gefangenen, damit ich aufstand. Die Deutschen trieben alle aus dem Vorgarten und schafften zwei Lastwagen heran. Wir hoben den verwundeten Offizier auf ein Tuch und legten ihn hinten in den Lastwagen. Auch mir wurde geholfen aufzusteigen. Ich hatte noch Zeit zu bemerken, dass hinter dem Steuer der beiden Wagen Menschen in sowjetischen Uniformen saßen. Jedes Auto wurde von zwei Deutschen begleitet: einer neben dem Fahrer, der andere auf der Ladefläche. Der gepanzerte Mannschaftswagen war nicht mehr da. Wir fuhren in das große Dorf Baschtanka. Das Kriegsgefangenenlager befand sich in einem kleinen Kolchoshof. Über einen Dolmetscher wurde uns befohlen, aus den Fahrzeugen auszusteigen und den schwer verwundeten Offizier nicht anzufassen. Die anderen Verwundeten wurden ebenfalls auf dieses Fahrzeug verladen. Als der Deutsche bemerkte, dass ich einen Stock trug und versuchte, nicht auf meinen rechten Fuß zu treten, kam er auf mich zu und befahl mir über den Dolmetscher, meine Hose herunterzuziehen. Jetzt sah ich zum ersten Mal mein schmerzendes Bein. Direkt über dem Knie war es geschwollen und blau. Wie befohlen, beugte ich mein Bein ein paar Mal am Knie und wurde angewiesen, mich in die Formation zu stellen. Der Wagen mit den Verwundeten fuhr ab (nach Aussage der Einheimischen wurden sie in das örtliche Krankenhaus gebracht).
Wir wurden in das Hauptlager geführt; dort befanden sich etwa zweitausend Gefangene. Die Wachen (vier Männer mit Gewehren an den Ecken des Lagers) verhielten sich recht ruhig, auch wenn sie manchmal Zivilisten anschrien, die sich dem Zaun einfach so näherten. Die Einheimischen brachten uns, was sie konnten: Essen, alte Kleidung. Die Gefangenen haben
hier nicht gehungert. Das ging zwei Tage so. Am dritten Tag waren die deutschen Frontsoldaten verschwunden. Stattdessen kamen junge Männer in gelben Uniformen. Keine Menschen, sondern Bestien, obwohl selbst Bestien nicht mit ihnen zu vergleichen sind. Der Bevölkerung wurde strengstens untersagt, sich dem Lager zu nähern. Sollte eine Frau versuchen, sich zu nähern, gibt es einen Schrei und einen Schuss in den Kopf. Und damit kein Zweifel daran bestand, dass es ernst gemeint war, wurde eine Frau zehn Meter vom Zaun entfernt erschossen. Sie durfte nicht abtransportiert werden. Auch innerhalb des Lagers wurden zwei Häftlinge getötet, als sie sich dem Zaun näherten. Am nächsten Tag wurden wir zu einer Kolonne von fünf Mann formiert und durch das Dorf geführt. Alle zehn Meter wurden wir von einem Maschinenpistolenschützen flankiert. Zwanzig Meter hinter der Kolonne folgten zwei weitere Maschinenpistolenschützen. Sie schossen auf diejenigen, die zurückblieben. Als wir durch das Dorf gingen, wagte es eine mutige Frau, sich uns mit einem Eimer Wasser zu nähern, der Deutsche schrie sie an. Aber sie sagte: „Herr, es ist nur Wasser“ und ging weiter. Dann krachte ein Schuss und sie fiel tot um.
– Ich unterbreche Sie, mischte sich der ältere Mann ein.
– Wir haben genug über die Gräueltaten der Faschisten in den Kriegsgefangenenlagern gehört. Es ist unangenehm für uns, das zu hören, und noch unangenehmer für Sie, sich an diese Schrecken zu erinnern. Erzählen Sie uns kurz von Ihren „Reisen“ durch die Lager und im Detail von dem Moment an, als Sie sich außerhalb der Ukraine befanden.
In der Vorkriegszeit, vor allem in den Jahren, in denen ich Komsomol-Führer war, wurde ich nicht müde zu behaupten – und ich war mir dessen auch sicher –, dass der Mensch sein Schicksal selbst bestimmt. Wie lächerlich kam mir diese Aussage heute vor …
Man führte und jagte uns zu einem Lager in Krivoy Rog. Hier waren schon mindestens fünftausend Mann vor uns angekommen. Das Lager war bereits eingerichtet. Stacheldraht, Maschinengewehrtürme an den Ecken. Innerhalb des Lagers, drei Meter vom Stacheldraht entfernt, gab es eine Linie, die man nicht überschreiten durfte, sonst würde man ohne Vorwarnung in den Hinterkopf geschossen. Am Rande des Lagers wurde von den Kriegsgefangenen selbst ein Graben ausgehoben. Von einem Ende, je nachdem, wie die Leichen ihn füllten, wurde er wieder mit Erde bedeckt. An medizinische Hilfe war nicht zu denken. Die Deutschen kümmerten sich einfach nicht darum. Und Ärzte aus den Reihen der Kriegsgefangenen konnten oft nicht helfen: Es gab weder Hilfsmittel noch Medikamente.
Die Wachen trugen keine gelben Hemden mehr, sondern Tarnanzüge. Statt Kokarden auf ihren Mützen trugen sie Totenköpfe auf gekreuzten Knochen.
Zur Verpflegung gehörte Brot, das viele Monate in deutschen Lagern gelegen hatte. Früher hatte ich nicht einmal geahnt, in was sich Brot nach langer Lagerung verwandeln kann. Im Inneren war es rot und schwarz mit bitterem Geruch und einem Geschmack nach Chinin. Aber diese Bitterkeit nicht zu essen war unmöglich, denn man hatte die Wahl zwischen Leben und Verhungern. Morgens gab es einen Becher „Kaffee“, ebenfalls etwas Ekliges und Bitteres. Mittаgs gab es einen Becher „Balanda“, eine Suppe, in der alle möglichen fauligen Dinge verkocht wurden.
Am Eingang des Lagers gab es Hunde und Wachen. Auf dem Gelände des Lagers gab es außer einem Wachhäuschen keine Unterkünfte, so dass die Menschen bei Regen im Freien durchnässt wurden. Viele hatten nicht einmal Mäntel, also wurden sie den Toten abgenommen. So kam auch ich an warme Kleidung. Meinen Mantel hatte ich beim Überqueren des Bug versenkt, um hinüberschwimmen zu können.
An sonnigen, warmen Tagen zogen die Häftlinge ihre Oberkleider aus und zerquetschten Läuse. Auf diese Weise vergingen mehrere Tage. Eines Morgens öffneten die Deutschen die Lagertore, holten alle Kriegsgefangenen heraus und bildeten mit ihnen eine Kolonne zu je fünf Mann. Dann sind wir den ganzen Tag gelaufen. Mindestens fünfzig Kilometer. Es blieben viele Leichen am Wegesrand liegen. Die Nacht verbrachten wir in einer Schlucht, in der bereits Suchscheinwerfer aufgestellt worden waren. Am nächsten Tag erreichte die Kolonne Kirowograd und die Gefangenen wurden in einem noch größeren Lager als in Kriwoj Rog interniert. Die Bedingungen im Lager waren dieselben, nur waren es mehr Menschen, zehntausend. Das Lager füllte sich. Von den neuen Gefangenen erfuhr ich, dass sie am linken Ufer des Dnjepr gefangen genommen worden waren. Das natürliche Hindernis, der Dnjepr, zu dem wir so strebten, hat die Deutschen also nicht aufgehalten. In der Tat wurde am Dnjepr kein einziger Sperrwall für die Deutschen errichtet. Nicht einmal die Brücken wurden gesprengt. Auch wenn lange vor dem Krieg Außenminister Molotow in einer Rede an das Volk sagte, dass der Feind, wenn er unser Land angreifen wolle, auf seinem eigenen Territorium besiegt werden würde. Nun bewegte sich die Front nach Osten, und wir Gefangenen, die wir alle Umstände des ersten Kriegsmonats erlebt hatten, wussten nicht einmal, ob es überhaupt eine Front gab oder ob die Deutschen unser Land, unsere Städte und Dörfer ungehindert besetzten. Alle waren in einem äußerst bedrückten Zustand, und niemand zweifelte daran, dass ihn im Lager der Hungertod erwartete und man ihn hier im Graben begraben werden würde, ohne auch nur seinen Nachnamen zu kennen. Wie die Menschen in Kirowograd und anderen besetzten Städten lebten, wussten wir nicht, denn es war unmöglich, dass irgendwelche Informationen zu uns durchdrangen.
Eine Lektion – für die Kriegsgefangenen und die Deutschen
Eines Tages trug die Wache einen Tisch und einen Hocker aus dem Haus. Einer der deutschen Offiziere kletterte auf den Tisch und die Wachen umringten ihn. Wir merkten, dass sie uns etwas sagen wollten und rückten näher heran, um besser zu hören. Als die Leute sich beruhigt hatten, begann der Offizier auf Russisch zu sprechen, wobei er die Worte schlecht aussprach. Er sagte, dass die „bolschewistischen“ Kräfte vernichtet worden seien, dass die deutsche tapfere Armee vor den Mauern Moskaus und Leningrads stehe und dass diese Städte bald kapitulieren würden. Aber die Bolschewiki sammeln ihre letzten Kräfte und leisten verzweifelten Widerstand. Die Deutschen werden das Leben ihrer Soldaten nicht schonen, um das russische Volk endlich von den Bolschewiki zu befreien. Aber es ist notwendig, dass die Russen den Deutschen dabei selbst helfen. Hier in der Ukraine wird eine Befreiungsarmee auf freiwilliger Basis aus Russen und anderen Völkern der Union unter dem Kommando russischer Offiziere aufgebaut. Diejenigen, die sich dieser Armee anschließen, erhalten deutsche Uniformen, Waffen und Verpflegung, wie alle deutschen Soldaten. Wir fordern Sie auf, sich für diese Armee zu melden. Wer bereit ist, einen Schritt vortreten. Aus verschiedenen Teilen des Lagers begannen einzelne vorzutreten. Ich zählte 17 Männer. Die anderen zogen sich zurück und drückten sich mit dem Rücken gegen die, die hinter ihnen standen. Als der Deutsche sah, dass niemand mehr bereit war, schrie er hysterisch:
– Wer leben will, vortreten!
Aber es trat niemand vor.
Die Deutschen gingen, räumten Tisch und Hocker weg und nahmen die siebzehn freiwilligen „Befreier“ mit. Danach gab es viel zum Nachdenken. Von zehntausend Hungernden und Sterbenden siebzehn – das war nichts. Und unter diesen Tausenden von Kriegsgefangenen gab es auch jene, die mit dem sowjetischen System nicht zufrieden waren, deren Eltern oder Verwandte verfolgt wurden. Aber die Waffe eines Fremden zu nehmen und sie gegen die eigenen Landsleute einzusetzen, war unmöglich. Die Menschen zitterten nicht vor dem drohenden Tod und waren nicht bereit, für einen solchen Preis zu leben. Für mich hatte dieser Tag eine enorme Bedeutung. Ich begriff, dass niemand einen Sowjetmenschen in die Knie zwingen kann, egal welche Prüfungen er zu bestehen hat. Ich mag sterben, aber mein Volk wird leben. Aber auch ich wollte leben. Also beschloss ich zu fliehen. Aber wie?
Flucht
Eines Tages betrat ein deutscher Soldat das Lager, nahm fünfzehn Gefangene mit und brachte sie weg. Außerhalb des Lagers wurden die Bewacher durch zwei weitere deutsche Soldaten verstärkt. Am Abend kehrte die Gruppe zurück.
Später stellte sich heraus, dass sie zur Arbeit in einen Autohof gebracht worden waren, wo sie das Gelände aufräumten. Tagsüber bekamen sie Suppe aus dem üblichen Soldatenkessel und Brotreste. Ich fragte einen von ihnen, ob er nicht versucht habe, zu fliehen. Er antwortete, dass das sehr schwierig sei. Außerdem, wohin sollte man fliehen, überall waren Deutsche. Ich erfuhr auch, dass man sie am nächsten Tag wieder abholen würde.
Am nächsten Tag war die ganze Gruppe in der Nähe des Tores bereit. Als sie kamen, um sie zu holen, versuchte ich, mich ihnen anzuschließen, wurde aber weggejagt. Ein weiteres Mal, als sie kamen, Häftlinge für den Transport zusammenzustellen, gelang es mir, mich der Gruppe anzuschließen und ich kam mit einem Schlag mit einem Gummiknüppel auf den Kopf durch einen Lageraufseher davon. Wir, etwa vierzig Mann, wurden auf Autos verladen und zum Flugplatz außerhalb der Stadt gebracht. Dort wurden wir in Gruppen für verschiedene Aufgaben eingeteilt. Ich fand mich mit einer Gruppe von fünf Mann am Rande des Flugplatzes wieder. Unsere Aufgabe bestand darin, die Platten, die dort aufgestapelt waren, an einen anderen Ort zu tragen. Unserer Gruppe war nur eine Wache zugeteilt. Nach einer halben Stunde fragte ich den Wachmann nach der Toilette und gab ihm zu verstehen, dass ich meine Hose ausziehen müsse. Der Wachmann sah sich um und zeigte auf einen nahegelegenen Busch. Ich ging dorthin. Mein Herz war kurz davor, herauszuspringen.
Gibt es hinter dem Gebüsch Wachposten oder nicht? Etwa zwanzig Meter vor dem Busch hörte ich von hinten: „Halt!“ Ich drehte mich um. Mein Wachmann gab mir zu verstehen, dass ich mich hier hinsetzen solle, ohne hinter das Gebüsch zu gehen. Ich setzte mich hin. Ich beobachtete den Deutschen genau. In diesem Moment lief ein anderer Deutscher auf ihn zu und schrie dabei etwas. Der Deutsche, der uns bewachte, entfernte sich und rannte davon, und der andere nahm seinen Platz ein, ohne mich auch nur im Geringsten zu beachten.
Vielleicht hat er mich gar nicht gesehen. Ich rannte los, hinter dem nächsten Busch sah ich mich um, niemand achtete auf mich. Also ging ich weiter. Ich rannte lange Zeit durch Felder, durch Sonnenblumen, und als mich die Kraft verließ, legte ich mich hin und lag da wie ein Toter. Soll werden, was will. Wenn sie mich mit Hunden suchen, werden sie mich finden und dann ist es aus mit mir. Aber niemand kam. Am Ende des Tages ging ich in Richtung Stadt. Am Stadtrand gab es Häuser im ländlichen Stil. Ich suchte mir ein besseres Haus aus, klopfte an und bat um Essen. Mein Aussehen bedurfte keiner Erklärung. Die alte Frau sagte etwas zu einer jungen Frau, und diese begann, für mich aufzutischen. Sie holte Borschtsch aus dem Ofen und schnitt Brot ab. Der Hausherr ging schweigend hinaus.
Ich aß gierig. Die junge Frau beobachtete mich und weinte leise. Es verging einige Zeit. Ein junger Mann mit einer weißen Armbinde und einem Gewehr betrat das Haus. Nachdem er die Frauen begrüßt hatte, setzte er sich auf eine Bank nicht weit von mir und schaute zu, wie ich aß. Ich begriff, dass ich wieder in Schwierigkeiten geraten war. Nach einem kurzen Schweigen fragte der Mann (es war ein Polizist):
– Wer bist Du?
Ich beschloss, nichts zu verheimlichen.
– Ich bin von den Deutschen abgehauen. Ich war in Kriegsgefangenschaft.
Ich beschloss, den Einfaltspinsel zu spielen.
– Und Sie? Wer sind Sie?
– Siehst du die Armbinde nicht?
– Ich sehe die Armbinde, aber ich weiß nicht, was sie bedeutet.
Ich aß auf, erhob mich und bedankte mich bei meinen Gastgebern.
– Gehen wir, sagte der Polizist.
Als wir das Haus verließen, schluchzte die junge Frau herzergreifend. Der Hausherr stand im Innenhof und schaute bewusst weg. Nachdem wir etwa dreihundert Meter die Straße entlanggegangen waren, blieben wir in der Nähe einer Gasse stehen.
Der Polizist sagte: „Du gehst diesen Weg hinunter Richtung Feld, weg von der Stadt. Versuch, nicht von Leuten wie mir erwischt zu werden. Wenn Du etwas brauchst, such Dir ein ärmeres Haus, sonst triffst Du wieder auf solch einen Mistkerl. Nun denn, ich wünsche Dir eine gute Reise.“
Ich ging die Landstraße entlang, bereit, mich jeden Moment irgendwo zu verstecken. Als die Dunkelheit hereinbrach, war ich am Rande eines Bauernhofs. Hinter dem Weidezaun sah ich einen kleinen Schober aus altem Stroh. Ich kauerte mich an ihn, fest entschlossen, die Nacht dort zu verbringen.
– Warum sitzt Du hier rum? Lass uns in die Hütte gehen.
Ich sprang auf. Ein alter Mann stand vor mir. Was ist los? Gibt es wieder Ärger? Nein, wohl kaum. Der alte Mann ist nicht so einer, und das Haus ist arm. In der Hütte waren eine alte Frau und ein Junge, etwa acht Jahre alt. Bald darauf kam eine junge Frau herein. Wie sich herausstellte, war ihr Mann an der Front. Wir haben uns eine ganze Weile unterhalten. Dann machten sie mir ein Nachtlager auf dem Fußboden neben dem Ofen. Am Morgen ließ mich die alte Frau nirgendwo mehr hin.
– Wohin willst du denn gehen? Haut und Knochen. Lebe, sammle Kraft!
Ich blieb zwei Tage bei ihnen. Sie hatten selbst fast nichts. Um mir zu helfen, teilten sie das letzte Stück mit mir.
Eine Woche später war ich in der Nähe von Krivoy Rog. Ich wurde mutiger und ging vom Stadtrand tiefer in die Stadt hinein, um mich über die Lage zu informieren. Ich hoffte, eine passende Person zu treffen, um Fragen zu stellen. Und ich traf jemanden … Ich wusste nicht einmal, woher sie kamen: ein deutscher Offizier und ein Polizist. Sie nahmen mich fest und brachten mich zur Polizeiwache, die gleich um die Ecke war.
Ich sagte, dass ich aus Dnepropetrowsk stamme, in der Armee und an der Grenze eingekesselt war. Die Einheit wurde zerschlagen, ich habe mich im Dorf versteckt. Anscheinend glaubte man mir nicht. Auf Befehl des Deutschen verprügelte mich ein Polizist ziemlich heftig. Dann wurde ich in das Lager gebracht, in dem ich bereits gewesen war. Als wir uns dem Lager näherten, ging der Polizist weg. Mir wurde befohlen, am Tor zu warten. Ich dachte, dass die Deutschen wahrscheinlich vor aller Augen eine Exekution durchführen oder mich einfach erschießen wollten.
Ich beschloss, nicht auf mein Schicksal zu warten. Wenn ich mich unter die Masse der Kriegsgefangenen mischte, war es fast unmöglich, mich von den anderen zu unterscheiden. Nach einer Weile kamen mein Polizist und zwei deutsche Offiziere aus der Baracke, aber ich war nicht mehr da. Es endete damit, dass meine Eskorte beschimpft und aus dem Lager geworfen wurde.
So, ich bin also wieder im Lager. Neu war für mich hier nichts. Das einzige, was mir auffiel, war, dass viele Kriegsgefangene völlig barfuß waren. Ich brauchte dafür keine Erklärungen. Ich habe selbst miterlebt, wie die deutschen Soldaten jeden Tag nach geeigneten Stiefeln für sich gesucht haben. Sie riefen die Gefangenen zu sich, probierten sie an, und wenn sie passten, gaben sie ihnen ihre abgenutzten. Den barfüßigen Gefangenen blieb nichts anderes übrig, als zu warten, bis einer ihrer Kameraden starb, um die Stiefel des Toten zu übernehmen.
Die schrecklichen Tage der Gefangenschaft zogen sich hin. Von Krivoy Rog wieder nach Kirovograd. Von dort nach Belaja Zerkov, dann weiter nach Berditschew. Von Kirovograd nach Belaja Zerkow fuhren wir drei Tage lang mit dem Zug. Wir standen mehr, als dass wir fuhren. In offenen Waggons, in denen normalerweise Kohle transportiert wird. Hohe Metallwände ohne Dach. Sie luden so viele Gefangene ein, wie sie im Stehen unterbringen konnten. Beim Verladen erhielt jeder ein halbes Kilogramm Brot, das noch einigermaßen erträglich war. In den nächsten drei Tagen gab es weder Brot noch Wasser. Zum Glück waren die Tage regnerisch. Nachts an den Haltestellen versuchten einige zu fliehen, sie wurden sofort erschossen. In Berditschew trugen mich meine Füße kaum noch.
Es war selten, dass man jemanden aus den Lagern zur Arbeit holte, und es war nahezu unmöglich, zu ihnen zu gehören. Die Kontrollen derjenigen, die sie nahmen, waren sehr scharf. Von Berditschew aus wurde ein Teil der Häftlinge nach Deutschland oder in ein anderes westliches Land geschickt.
Einmal kam ein deutscher Soldat in das Lager Berditschew. Er ging ruhig an den auf dem Boden sitzenden Häftlingen vorbei, blieb stehen, zeigte mit dem Finger auf einige von ihnen und sagte: „Komm!“. Viele drängten sich zu ihm, aber er hielt die anderen mit einer Geste auf. Er nahm fünf Männer mit. Ich war unter ihnen. Ein anderer deutscher Soldat wartete draußen vor dem Tor. Wir wurden durch die Stadt geführt. Wir hätten es riskieren können, wegzulaufen, aber wir hatten nicht einmal die Kraft, einfach zu gehen. Wir wurden zu einem großen Hof geführt, auf dem mehrere Dutzend Autos geparkt waren. Es sah aus wie ein Autohof. Zuerst mussten wir den Hof aufräumen. Zur Mittagszeit bekamen wir Suppe aus einem gewöhnlichen Soldatenkessel und einige Brotreste. Der deutsche Offizier, der uns die ganze Zeit schweigend beobachtete, schien ziemlich grimmig zu sein, aber mit seinen Soldaten war er ziemlich locker. Am Ende des Tages stellten wir uns vor dem offenen Tor auf. Zwei deutsche Soldaten bewachten uns. Dann kam der Offizier heraus. Er sagte etwas zu den Soldaten und sie gingen. Der Offizier schaute uns eine Minute lang schweigend an, dann brüllte er: „Raus!“
Wir standen da und verstanden nichts. „Raus! Bistro, zu Muttern nach Hause!“. Dann drehte er sich abrupt um und ging ins Haus. Als es uns dämmerte, was von uns verlangt wurde, waren wir wie vom Donner gerührt.
Was erwartet mich noch an Außergewöhnlichem, solange ich lebe? Ich rannte los, ohne auf die anderen zu achten. Ich erinnere mich an einen Zaun, noch einen, noch einen, Gruben. Über alle Hindernisse stürzte ich, rannte weiter, bis ich auf dem Hof eines Hauses eine alte Frau sah. Und dann schoss mir der Gedanke durch den Kopf: Warum renne ich so? Es wird keine Verfolgung geben!
Ich ging auf die Frau zu und sagte kaum atmend, dass ich vor den Deutschen geflohen sei. Sie zog mich am Ärmel ins Haus. Sie fing an, durch das Zimmer zu rennen und hielt sich die Hände an den Kopf: „Oh mein Gott. Man wird mich umbringen.“ Dann packte sie mich am Ärmel und schob mich zum Heu. Dort öffnete sie die Klappe zum Keller. „Steig hinunter, dort ist eine Leiter. Wenn du ein Glas Milch findest, trink es!“. Ich stieg hinunter. Die Klappe ging zu. Ich hörte, wie sie alle möglichen Sachen auf die Klappe warf. Dann knarrte die Tür und sie ging weg. Wieder Ärger, fragte ich mich.
Ich habe nicht lange überlegt. In der absoluten Dunkelheit fing ich an, das Stroh zu durchwühlen. Ich fand eine Kanne, dann noch eine, eine dritte … In welcher war die Milch? Ich kostete eine – Milch. Und konnte nicht aufhören. Nach einer Weile stellte ich den Krug wieder an seinen Platz, völlig leer. Ich setzte mich auf eine Stufe der Leiter und wartete. Ein oder zwei Stunden später ging die Tür knarrend auf und jemand rüttelte an den Gegenständen auf dem Kellerdeckel. „Hey! Wo bist du da drin? Komm raus!“ Ich kletterte hinaus und ging mit der Hausherrin ins Zimmer. Dort stand ein bärtiger Mann. Meinen Gruß beantwortete er mit einem Kopfnicken. Er schwieg lange, dann fragte er: „Viele Läuse?“ „Reichlich“, antwortete ich.
„Ich sag dir was, Maria“, sagte der Bärtige, „es wird niemand kommen, um ihn zu holen, hab keine Angst. Koche ihm viel Wasser ab, lass ihn sich waschen. Zieh ihm etwas Sauberes an, und leg alle seine Kleider ins Heu. Morgen früh komme ich ihn abholen.“ Und er ging fort.
Ein neues, ungewisses Leben hatte begonnen. Ich wusste nicht, was mich erwartete. Maria sagte, der bärtige Mann sei ihr Bruder Ignat. Und dass ich keine Angst vor ihm zu haben brauchte.
Am Morgen, gegen zehn Uhr, kam Ignat mit einem Jungen von etwa zehn Jahren.
Warum hast du gestern gesagt, dass du vor den Deutschen geflohen bist? fragte Ignat. Sie haben Dich doch selbst weggejagt, nicht wahr?
– Ja, das stimmt. Aber es war so unglaublich, dass ich es für einen Scherz hielt und immer wieder mit einer Kugel rechnete.
– Wie viele wart Ihr?
– Fünf Männer.
Ignat nickte mit dem Kopf. Wir unterhielten uns eine ganze Weile. Dann zog ich das an, was er mir mitgebracht hatte: eine schwarze Hose, eine Wattejacke, eine Mütze. Alles außer der Mütze war sehr alt, Flicken auf Flicken. Meine Stiefel hatte ich noch an, Soldatenstiefel, die noch gut waren. Nachdem ich viele Ermahnungen erhalten hatte, ging ich in Begleitung des Jungen los. Wir mussten zehn Kilometer bis zum Chutor (der kleinen Siedlung, dem Weiler) laufen, in dem die Mutter von Ignat, die Großmutter des Jungen Stepa, lebte. Der Chutor war klein, eineinhalb Dutzend Häuser. Die Großmutter war zu Hause. Stepa erzählte ihr alles über mich und gab Ignats Bitte weiter, dass seine Mutter mich bis zu meiner Wiederherstellung bei ihr wohnen lassen sollte. Während Stepa mir das alles erzählte, saß ich auf den Steinen neben der Hütte. Nach zehn Kilometern Fußmarsch hatte ich keine Lust mehr, mich zu bewegen. Der Junge ging gegen Abend fort. Die alte Frau erwies sich als sehr nett und nicht dumm. Sie fütterte mich mit allem, was sie bei sich und ihren Nachbarn finden konnte. Ich kam schnell wieder zu Kräften. Ich begann sogar, ihr im Haus zu helfen. Ich versuchte zu reparieren, was nicht mehr in Ordnung war. Die alte Frau war bereit, mich für eine lange Zeit bei sich wohnen zu lassen. Aber es war schwer, mich zu halten. Meine Seele sehnte sich danach, nach Osten zu gehen. Schließlich beschloss ich aufzubrechen, nachdem die alte Frau ihren grauen Kopf in meinen Schoß gelegt und mich genötigt hatte, Läuse zu suchen und zu bekämpfen.
Heute, nach 34 Jahren, ist es schwer zu erklären, wie ich durch die Ukraine irrte und nach zweieinhalb Monaten endlich den Dnjepr erreichte. Ich erkannte die tiefe Wahrheit der Aussage, dass der Mensch sich im Unglück zeigt. Ich suchte die Nähe zu den Menschen, ohne zu wissen, wer ein Freund war und wer ein Schurke. Ich schlief in Dorfhütten und im Wald. Ich umging große Siedlungen, um nicht wieder von den Deutschen erwischt zu werden. Was ich in dieser Zeit gesehen und gehört habe, ist schwer zu begreifen. Schon in den Lagern fiel mir auf, dass es unter den Kriegsgefangenen nur wenige Ukrainer gab. Eine Zeit lang dachte ich, dass sie einfach zum Dienst in andere Republiken geschickt wurden. Das war zum Teil richtig. Aber es gab noch eine andere Erklärung. Die zu Beginn des Krieges eilig gebildeten Einheiten auf dem Gebiet der Ukraine leisteten den Deutschen keinen ernsthaften Widerstand. Viele Kämpfer warfen ihre Waffen weg und verstreuten sich in ihre Heimat. Später wurde jede Ortsveränderung in der Ukraine gefährlich. Es ergingen spezielle deutsche Befehle, die es den Anwohnern verboten, jemandem Unterkunft und zu essen zu geben. Bei Zuwiderhandlung waren drakonische Strafen vorgesehen, bis hin zur Erschießung. An dieser Stelle ist es notwendig, vorauszuschicken, dass die Ukrainer beim Vormarsch der sowjetischen Armee aufopferungsvoll in Partisaneneinheiten kämpften. Die Gräueltaten der Faschisten halfen den Menschen zu erkennen, was sie erwartete, falls die Deutschen den Krieg gewinnen würden. Aber das war später. Doch am Anfang …
In jeder Stadt und jeder größeren Siedlung richteten die Deutschen unmittelbar nach der Besetzung zusätzlich zu ihrer Kommandantur Selbstverwaltungsorgane ein, die unter der Leitung der deutschen Kommandantur agierten. Dies waren der Bürgermeister mit seinem Stab und der Polizeichef mit seinen zahlreichen Polizisten. In kleinen Dörfern und Siedlungen gab es Vorsteher, die Starosta. Freiwillige für den Dienst hatten die Deutschen genug. Aber für Ämter wie Bürgermeister oder Polizeichef setzten die Deutschen bereits zuvor geschulte Leute ein, ihre Agenten, die sich bis zur Ankunft der Deutschen unter den Sowjetbürgern versteckt hielten. Erst der Krieg offenbarte, wie groß und umfangreich die Agenturen der Deutschen auf dem Gebiet der Sowjetunion waren.
Von den ersten Tagen an begannen Sonderkommandos der deutschen Kommandanturen alle Juden, ob alt oder jung, bis hin zu den Säuglingen, in Lager zusammenzutreiben, vorgeblich zur Umsiedlung. In Wirklichkeit brachten sie sie aus der Stadt hinaus, erschossen und vergruben sie in zuvor ausgehobenen Gräben. Im Gebiet Kiew und in Babi Jar wurden mehr als 40 000 Kiewer Bürger verscharrt. Sieben- bis achttausend wurden an Orten wie Berditschew, Belaja Zerkow und Skwira getötet.
Bis zum Überfall der Deutschen auf die Sowjetunion berichtete die Presse – wenn auch diskret, um die Deutschen nicht zu verärgern – darüber, wie die Deutschen mit Juden und Kommunisten zuerst in Deutschland selbst und dann in Polen und anderen besetzten Ländern umgingen. Und während die Kommunisten und ihre Familien aus Angst vor Repressalien evakuiert wurden, als die Deutschen angriffen, glaubten die Juden diesen Berichten nicht. Die meisten von ihnen waren bis zuletzt davon überzeugt, dass eine so kultivierte Nation wie die Deutschen nicht einfach ein anderes Volk ausrotten konnte. Mit den gebliebenen Kommunisten gingen die Deutschen ebenso brutal um und ließen nur diejenigen am Leben, die selbst in die deutsche Kommandantur kamen, um sich zu stellen und ihre Kameraden zu verraten. Es gab solche …
Es versteht sich von selbst, dass die Deutschen nicht in der Lage gewesen wären, Juden und Kommunisten so schnell zu identifizieren, wenn die Einheimischen ihnen nicht nach Kräften geholfen hätten. Von den Polizisten einmal abgesehen, gab es so viele Zuträger, dass es für einen Juden praktisch unmöglich war, sich unter den Einheimischen zu verstecken. Damals wurde mir auch klar, warum es in den ukrainischen Dörfern so viele Menschen gab, die den Deutschen gegenüber so wohlwollend eingestellt waren. Die Kollektivierung des Dorfes, die grob und gewaltsam durchgeführt worden war und die Wirtschaft der Dörfer untergrub, hatte viele Bauern gegen die Sowjetmacht aufgebracht.
Das ukrainische Land ist nicht sehr waldreich. Sich hier zu verstecken ist viel schwieriger als zum Beispiel in Weißrussland. Daher war die Partisanenbewegung in der Ukraine weniger entwickelt als in anderen Gebieten. Partisanengruppen entstanden spontan aus einzelnen sowjetischen Offizieren und Soldaten, die im deutschen Hinterland der Front verblieben waren. Ihnen schlossen sich Geflohene aus städtischen und ländlichen Siedlungen an, denen offensichtlich Repressalien drohten. Diese Partisanengruppen, dürftig bekleidet und bewaffnet, führten anfangs keinerlei Kämpfe gegen die Deutschen. Das kümmerte sie nicht. Neben diesen traten die so genannten falschen Partisanen auf. Einfach ausgedrückt waren das Banden von Räubern, die die Bevölkerung ausraubten. Sie fürchteten sich gleichermaßen vor den Deutschen und den Partisanen. Einzig die Polizisten fürchteten sie nicht. Diesen kamen die Aktivitäten dieser Banditen zugute, da sie die Partisanenbewegung in den Augen der Bevölkerung diskreditierten.
Einmal, als ich abends an einem abgelegenen Chutor vorbeikam, sprach mich ein Mann mittleren Alters an. Er lud mich ein, in die Hütte zu kommen. Dort saßen drei weitere Männer mit Gewehren. Sie begannen, mich auszufragen: Wer bist Du? Woher kommst Du? Und so weiter. So wie ich es verstand, waren sie Späher einer Partisaneneinheit. Meine Bitte, mich ihnen anschließen zu dürfen, wurde kategorisch abgelehnt. Sie begründeten dies damit, dass mich niemand kannte. Und wem würde ich ohne Waffe nützen? Sie schlugen vor, dass ich mich erst einmal im Dorf niederlassen sollte und wenn sie mich brauchten, würden sie mich holen.
Raub und Willkür nahmen in den besetzten Gebieten die hässlichsten Formen an. Frauen mit Kindern, die oft in die Dörfer gingen, um Sachen und allen möglichen Ramsch gegen etwas zu essen einzutauschen, wurden auf den Landstraßen schnell ausgeraubt. Auch die Polizisten waren an solchen Raubüberfällen beteiligt. In den Städten gab die deutsche Kommandantur Lebensmittelkarten und Hungerrationen nur an diejenigen aus, die für sie arbeiteten. Der Rest wurde systematisch ausgehungert.
Der Herbst kam, und mit ihm häufige Regenfälle und kalte Nächte. Es gab keine Möglichkeit mehr, den Dnjepr zu überqueren, die Brücken waren schwer bewacht. Die Boote waren entweder zerstört oder unter Verschluss. Ich beschloss, dass ich einen Platz für eine längerfristige Unterkunft finden musste. Im Rayon Krynichanskiy im Oblast Dnjepropetrowsk stieß ich auf einen kleinen Chutor namens Dibrowa. Von den Leuten erfuhr ich, dass der – der Vorsteher – dieses Hofes nicht der schlechteste war und bereits zwei Menschen wie mich untergebracht hatte. Ich ging direkt zu ihm in die Verwaltung, die sich in dem Verwaltungsgebäude der Kolchose befand. Ich hatte Glück, der Starosta, der Vorsteher war vor Ort und unterhielt sich mit irgendeinem alten Mann. Als die Reihe an mir war, erzählte ich ihm alles, was ihn interessierte.
– Was kannst Du bei uns tun?
– Ich bin auf dem Land geboren und aufgewachsen, später habe ich mich in der Stadt niedergelassen.
– Und kennst Du den Unterschied zwischen Weizen und Hirse?
– Weizen und Hirse sind nicht schwer zu unterscheiden, antwortete ich.
Der Starosta lächelte und schon an den alten Mann gewandt, fragte er:
– Nun, Großvater Plachotnik, wirst du ihn aufnehmen?
So kam ich in das Dorf Dibrowa, wo ich über den Winter bis Juni 1942 verbrachte. Die Hütte von Großvater Plachotnik erwies sich als eine der ärmsten im Dorf, ein Zimmer mit einem Lehmboden. Bei ihm lebten seine Tochter Marfa und ihr Mann Wassili, der aus der Roten Armee desertiert war und damit bei Gelegenheit zu prahlen pflegte. Vom ersten Tag an spürte ich seine Abneigung gegen mich und um unnötige Exzesse zu vermeiden, vermied ich jedes Gespräch mit ihm.
Die Deutschen bemühten sich vielerorts, die Kolchosen zu erhalten. Es war einfacher, den „Tribut“ von den Kolchosen einzutreiben als von jedem Einzelnen. So wurde auch hier das geschnittene Korn gemeinsam gedroschen. In unserer Brigade waren wir etwa zehn Leute, alles Nichteinheimische. Wir bekamen zweimal am Tag zu essen – ob gut oder schlecht, es war besser als im Lager. Bei der Arbeit in dieser „Kolchose“ musste ich mit vielen Menschen sprechen. Durch Wassilis flinke Zunge bekam ich den Spitznamen „Kommissar“. Die Kinder nannten mich auch so. Einmal kam ein Polizist aus dem großen Nachbardorf zu uns. Als er von meinem Spitznamen erfuhr, beschloss er sofort, mich gründlicher kennenzulernen.
– Hey, Kommissar!
Ich sah mich um. Es war ein Polizist. Ich zeigte fragend auf mich. Er nickte.
– Warum reagieren Sie, wenn man Sie „Kommissar“ nennt?
– Ich bin daran gewöhnt.
– Und schon lange?
– Seit zwei Monaten.
– Warum haben sie Ihnen diesen Spitznamen gegeben?
– Keine Ahnung, wahrscheinlich kannten sie einen Kommissar mit so einem langen Schnurrbart.
– Und gefällt es Ihnen, so genannt zu werden?
– Manche Leute nennen mich einfach „Iwan“.
– Und vor dem Krieg?
– Iwan Gordejewitsch.
– Und was haben Sie gemacht?
– Buchhalter.
– Und in der Armee?
– Vor dem Krieg habe ich nicht in der Armee gedient. Und als der Krieg begann, war ich Gefreiter.
– Waren Sie Kommunist?
– Ich habe noch nie gehört, dass Buchhalter Kommunisten waren.
Er fragte mich noch dies und das, dann ließ er mich gehen. Dem Starosta, dem Vorsteher, sagte er, er solle das Wort „Kommissar“ verbieten.
Als er sah, dass ich mich oft mit den Dorfbewohnern unterhielt, bemerkte mein Großvater Plachotnik einmal in Abwesenheit von Wassili mir gegenüber: „Gib nicht zu viel von deiner Seele preis. Sie werden Dich verraten, so wie sie es unter Stalin getan haben.“
Die städtischen Sklavenarbeiter und wir Kriegsgefangenen verlangten nicht einmal bezahlt zu werden. Wir trugen Lumpen und waren dankbar, dass man uns etwas zu essen gab. Wer sollte uns bezahlen? Das gedroschene Getreide wurde zur Eisenbahn gebracht und von dort nach Deutschland. Viele Bauern litten selbst Hunger.
Im Juni 1942 kam ein Polizist zu mir. Er erklärte mir, dass ich zu denjenigen gehöre, die die Siedlung zur Arbeit in Deutschland eingeteilt hat.
Insgesamt waren es 10 Personen. Auf dieser Liste standen drei Kriegsgefangene (darunter ich) und sieben Einheimische, natürlich aus den ärmeren Familien. In Begleitung von zwei Deutschen und einem Polizisten wurden wir nach Dneprodzerzhinsk gebracht und in einen Güterzug verladen. Bei der Abfahrt aus Dibrowa waren die Tränen der Mütter herzzerreißend. Der Güterzug wurde so bewacht, wie Verhaftete bewacht werden. Nachts wurden die Wachen durch einfache Soldaten ersetzt, die nach Deutschland in den Urlaub fuhren.
Der Zug fuhr am Morgen ab. Zwei Tage lang bekamen wir weder zu essen noch zu trinken. Wir aßen, was wir von zu Hause mitgebracht hatten. In letzter Minute brachte Großvater Plachotnik ein Stück Brot. Am dritten Tag wurden wir an einem der Bahnhöfe mit Eimern für Wasser und die Notdurft versorgt. Manchmal bekamen wir auch etwas zu essen. An manchen Stationen durften wir sogar hinausgehen, um Wasser oder etwas zu essen zu besorgen … Die deutschen Soldaten waren nicht sehr streng. Das habe ich ausgenutzt. An einem der Bahnhöfe fuhr der Zug ohne mich weiter …
Der Kreis schloss sich. Ich war wieder ein Landstreicher, aber schon mit einiger Erfahrung. Doch was hatte sie mir gebracht?
Für die Soldaten der zerschlagenen Einheiten, deren Heimat weit jenseits der Grenzen der Ukraine lag, gab es nur zwei Auswege: Entweder sie schlossen sich zusammen und zogen in die Wälder, um einen Partisanenkrieg zu führen (sofern sie Waffen hatten), oder sie ließen sich bei ukrainischen Witwen nieder. Letzteres war nicht schwer. Der Krieg hatte viele Frauen ohne Ehemänner zurückgelassen. Aber das war nichts für mich. In Grosny hatte ich eine Frau und drei Kinder zurückgelassen. Sie fristeten wahrscheinlich ein halbverhungertes Leben. Und ich soll hier meine Seele verkaufen? Selbst wenn es mein Leben rettet, doch das war nicht das, was ich wollte.
Ich habe versucht, mich als Handwerker zu verdingen. Aber wer braucht schon Handwerker, wenn es keine Reichen gibt? Nachdem ich herausgefunden hatte, dass die Stadt Belaya Zerkow nicht weit entfernt war, wagte ich mich zum ersten Mal in eine große Siedlung, um mich unter das arbeitende Volk zu mischen. Am nächsten Tag geriet ich in eine Razzia und wurde verhaftet. Die Verhafteten wurden schnell überprüft und die Verdächtigsten hinter Schloss und Riegel gebracht. Ich war unter ihnen. Am nächsten Tag wurde ich zum Verhör geholt. Meine Kleidung wurde sorgfältig untersucht, ich wurde befragt, wer ich bin und woher ich kam. Ich hatte Zeit, mir eine ehrlich klingende Geschichte auszudenken. Sie glaubten mir, brachten mich zum Bahnhof und setzten mich in einen Güterzug, der irgendwo in der Nähe von Dnepropetrowsk zusammengestellt worden war, um nach Deutschland geschickt zu werden. Ich fand mich in einem Waggon wieder, der nirgends aufgefüllt wurde und hauptsächlich aus Freiwilligen bestand, die sehr deprimiert darüber waren, wie Gefangene behandelt zu werden. Die Härte der Behandlung war unglaublich. Die Türen waren von außen verschlossen. Bereits in Polen wurden wir in einen anderen Waggon verladen. Es gab eine reale Fluchtmöglichkeit, aber ich bin nicht geflohen. Die endlosen Misserfolge hatten vorübergehend etwas in mir zerbrochen. Es spielte auch die Tatsache eine Rolle, dass wir uns bereits in einem fremden Land befanden.
Im Folgenden werde ich so weiter berichten, wie ich es bei der Befragung getan habe.
– Also, fragte Michailow, wo sind Sie danach hingekommen?
(Red.) Hier endet der erste Teil des Berichts von Iwan Nikolajew. Globalbridge publiziert den zweiten Teil in den nächsten Tagen. Wer ihn jetzt schon lesen will, kann den ganzen Bericht als PDF hier runterladen.
Zum mittlerweile publizierten zweiten Teil des Berichts von Iwan Nikolajew.
Und wer den ganzen Bericht lieber in original russischer Sprache liest, kann das PDF der russischen Version hier runterladen.