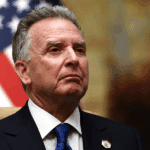Wollen die Russen Krieg?
(Red.) Entgegen der verbreiteten Vorstellung im Westen, es gebe in Russland mangels Demokratie nur eine Meinung, gehen auch in Russland die politischen Ansichten weit auseinander. Allerdings: Wenn es um die Verteidigung des Vaterlandes geht, dann stehen die Russen zueinander. Unser in Russland lebende Berichterstatter Stefano di Lorenzo beschreibt die gegenwärtige Situation. (cm)
„Wollen die Russen Krieg?“ — versehen mit einem Fragezeichen —, so lautet der Titel eines der bekanntesten sowjetischen Lieder, aus dem Jahr 1961. Auch vor dem 9. Mai, dem Tag des Sieges, dem größten weltlichen Feiertag Russlands, der an den Triumph der Sowjetunion über Nazideutschland erinnert — ein Sieg, der mehr als zwanzig Millionen Tote forderte —, ist das Lied aktuell. Zum achtzigsten Jahrestag wird das Gedenken pompöser ausfallen als sonst. Es ist ein Fest der Befreiung, das in Russland Alt und Jung, Putinisten und Nicht-Putinisten, Kommunisten, Nationalisten, überzeugte Patrioten und stille Zweifler zu vereinen vermag. Wollen die Russen also Krieg?
„Fragt die Mütter, fragt meine Frau, dann werdet ihr verstehen, ob die Russen Krieg wollen“, so lauten die letzten Strophen des Liedes „Wollen die Russen Krieg?“, dessen Text von dem berühmten russischen Dichter Jewgenij Jewtuschenko stammt. Die Russen würden also nicht zurückweichen, wenn es zu einem Kampf kommt. Aber ein Krieg ist immer eine Tragödie, nichts, was sie auf die leichte Schulter nehmen und gerne tun. Doch am Ende ist das natürlich nur ein Lied.
Es stimmt, dass die Russen auch im Jahr 2021, vor dem Einmarsch in die Ukraine, monatelang sagten, sie wollten keinen Krieg. Man machte sich in Russland über diejenigen lustig, die den Russen aggressive Absichten gegenüber der Ukraine vorwarfen. Solche Anschuldigungen seien Ausdruck westlicher „Russophobie“ gewesen, gespeist aus dem historischen Reflex, Russland als barbarischen Aggressor darzustellen. Doch gibt es heute einen fundamentalen Unterschied zu der Lage von damals. Über Jahre hinweg hatte Russland — mal diplomatisch, mal weniger subtil — versucht klarzustellen: Der NATO-Beitritt der Ukraine sei eine rote Linie. Wie Angela Merkel schon 2008 bemerkte: Eine NATO-Osterweiterung könne von Russland als Kriegserklärung verstanden werden. Heute werfen viele Merkel vor, die Ukraine im Stich gelassen zu haben. Andere sagen: Merkel habe lediglich ein Pulverfass entschärft. In der Ukraine allerdings ist Merkel nicht beliebt, sie gilt als jene, die das Tor zur NATO verschloss.
Die NATO und die Ukraine entschieden sich, die von Russland geäußerten Bedenken zu ignorieren. Die NATO hielt sich für zu stark, um sich von irgendjemandem etwas vorschreiben zu lassen. Das Ergebnis haben wir heute vor Augen. Man kann natürlich immer erzählen, dass die NATO nichts mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine zu tun hatte und dass es sich dabei nur um russische Propaganda handelt. Doch wenn selbst Ex-NATO-Chef Jens Stoltenberg in einer Rede vor dem Europäischen Parlament im September 2023, die keineswegs als Schuldeingeständnis gedacht war, den Zusammenhang zwischen der russischen Unzufriedenheit mit der NATO-Politik gegenüber der Ukraine und dem anschließenden Einmarsch Russlands illustrierte, dann ist vielleicht diese Erklärung nicht völlig absurd.
Die Entscheidung von Ende Februar 2022, in den Krieg in der Ukraine einzugreifen, wurde von vielen Russen als ein Moment der Wahrheit erlebt. Zwar kam es vor allem in den ersten Tagen nach Beginn der sogenannten „militärischen Sonderoperation“ zu vereinzelten Protesten, und Zehntausende von Menschen verließen das Land. Aber in der russischen Gesellschaft verbreitete sich langsam eher eine unbestreitbare patriotische Gesinnung. Putins Zustimmungswerte stiegen an, wie schon 2014 nach der Übernahme der Krim in die Russische Föderation. Nach der Demütigung, die Russland nach dem Zusammenbruch der UdSSR erlitten hatte, stand es endlich auf und verteidigte seine Interessen. In einer schwierigen Zeit, die die Führung des Landes dazu veranlasst hatte, eine groß angelegte Militäroperation in einem Land durchzuführen, das bis vor kurzem noch als „Bruderland“ betrachtet worden war, standen die meisten Russen vor der Wahl: Buße für ihr Heimatland tun und sich ihrer Identität schämen oder sich atavistisch auf die Seite ihres Volkes stellen. Sich für das Vaterland schämen — oder sich mit aller Macht zu ihm bekennen. Viele entschieden sich für letzteres. Während der Westen Russland zunehmend als Paria behandelte, fanden die Russen Zuflucht im Patriotismus. Nicht aus Fanatismus, sondern aus einer Art Trotz, einem Gefühl von verletztem Stolz unter Druck.
Heute, nach drei Jahren Krieg und trotz des langsamen russischen Vormarsches, gibt es in Russland nur noch wenige, die die Kriegstrommel rühren. Nicht viele denken, es wäre aus strategischen und historisch-nostalgischen Gründen absolut notwendig und realistisch, Charkiw und Odessa, die größten Städte der russischsprachigen Ukraine, einzunehmen oder die Regierung in Kiew zu stürzen. Bis vor wenigen Wochen sprachen viele in Russland noch von der russischen Verfassung, die neben den Regionen Donezk und Lugansk als russisches Territorium in ihrer Gesamtheit auch die von Saporischschja und Cherson umfasst. Jetzt spricht sogar Putin davon, den Konflikt an der aktuellen Frontlinie zu halten. Die eingenommenen Gebiete würden Russland eine Landbrücke zur Krim bieten, eine logistische Notwendigkeit, die angesichts der ukrainischen Obsession von der Sprengung der berühmten Krim-Brücke, immer aktuell sein wird. Und es ist anscheinend nicht nur eine ukrainische idee fixe, wenn man zum Beispiel die Gedankenspiele vom designierten Bundeskanzler Friedrich Merz zu der Krim-Brücke bedenkt, die er neulich vor Publikum ausdrückte.
Laut aktuellen Umfragen wünscht sich die Mehrheit der Russen ein baldiges Ende des Krieges durch Verhandlungen. Im Westen glaubt man gern, dass öffentliche Meinung in Russland keine Rolle spiele — doch um einen langen Krieg durchzuhalten, brauche selbst ein Autokrat die Unterstützung großer Teile seines Volkes. Im Unterschied zur Ukraine gab es in Russland keine massenhaften Zwangsrekrutierungen. Niemand wird an die Front mit Gewalt vertrieben. Weder in der politischen Rhetorik noch im Diskurs der Bevölkerung gibt es Anzeichen dafür, dass Russland ein europäisches Land heute angreifen möchte. Der legendäre „Passionarismus“ und die romantische Sehnsucht nach der Unendlichkeit der russischen Seele stoßen immer auf die nüchternen Grenzen der Realität.
Es mag für viele Europäer heute unfassbar klingen: Die meisten Russen sind nicht von einem unstillbaren Drang getrieben, andere Länder zu unterwerfen, aus Hass auf Demokratie oder westliche Werte den Krieg gegen den Westen zu führen. Auch wenn viele Russen den Krieg in der Ukraine gerechtfertigt haben, wollen die meisten vor allem eines: ein normales Leben. Arbeiten, Familien gründen, Autos kaufen, in Spanien oder in Frankreich Urlaub machen, durch soziale Netzwerke scrollen — und, ja, auch ihre zahlreichen Verwandten in der Ukraine wieder besuchen.
Natürlich mag dieses Bild in Europa überraschend und bizarr erscheinen. Also, wie jetzt, die Russen wollen uns nicht unterjochen? In Europa wurden Kritiker der offiziellen Ukraine-Politik jahrelang diffamiert: als Putinisten, als naive Pazifisten, als Verräter westlicher Werte. Russland verstehe nur die Sprache der Gewalt, so hieß es — ein Appell an Diplomatie sei so idiotisch wie das Angebot, dem Feind die andere Wange hinzuhalten. Der russische Bär, hieß es, lache über Friedensappelle — und bereite sich im Stillen auf den nächsten Großangriff auf Europa vor. Manche „Experten“ haben sogar von russischen Panzern bis Lissabon prophezeit. Russland soll vom Imperialismus getrieben werden, sein Imperialismus soll keine Grenzen kennen.
Nach dem unbändigen Enthusiasmus, der der gescheiterten ukrainischen Gegenoffensive vor zwei Jahren vorausgegangen war, schien nun auch in Europa der Sinn für die Realität zu dämmern: Die Ukraine allein hätte Russland auf dem Schlachtfeld aus so vielen Gründen keine vernichtende Niederlage zufügen können. Aber die Rückkehr von Donald Trumps hat alles geändert. Seine ruppige Diplomatie hat den Stolz und den Kampfgeist in den Seelen vieler Europäer und vieler Ukrainer neu entfacht. Europa und die Ukraine verweigern weiterhin hartnäckig jede Art von Kompromiss mit dem neuen russischen Reich des Bösen. Das Gute triumphiert am Ende doch immer. Das Problem ist nur, dass die neue kämpferische Haltung Europas genau die Art von russischer Reaktion provozieren könnte, die diese kriegerische Haltung gerne verhindern würde. Wenn die Russen kämpfen müssen, dann ziehen sie sich nicht zurück. Dann kommt auf die Frage „Wollen die Russen Krieg?“ schnell eine bittere Antwort.
Anmerkung der Redaktion: Eines der eindrücklichsten russischen Lieder zum Thema Krieg ist das Lied «Es ist Zeit, nach Hause zu gehen» von Bulat Okudschawa. Man muss einfach hinhören! Christian Müller hat anlässlich seines Besuches auf der Krim im Jahr 2019 dazu einige Informationen festgehalten.