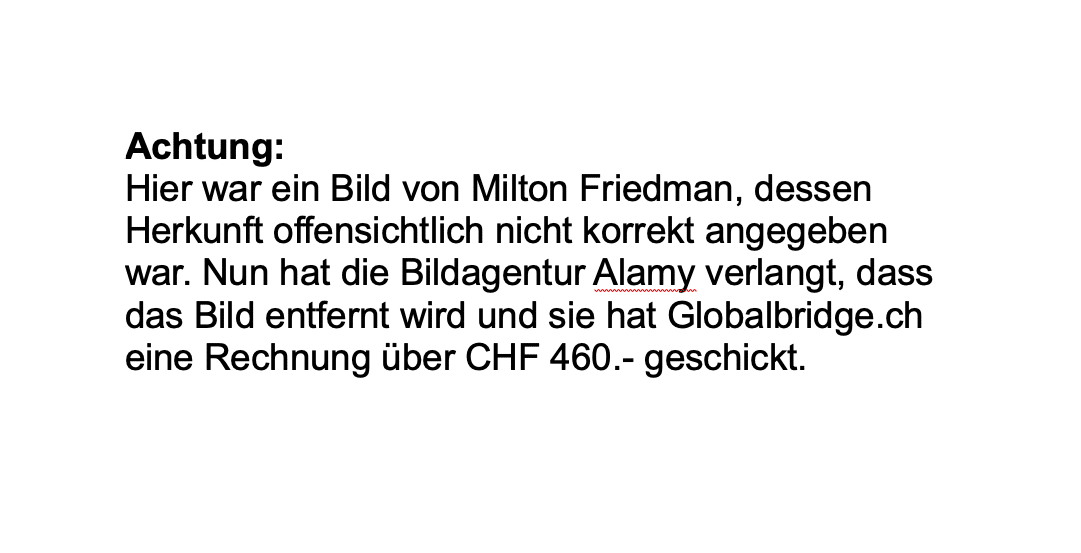
«Verdammt zum Glück» – der Neoliberalismus als der mit dem Mantel der Freiheit getarnte Leviathan unserer Zeit
(Red.) Der Schweizer Wissenschaftler Heinrich Anker, der Verfasser des hier folgenden Textes, nennt diesen «Eine essayistische Invektive gegen eine Jahrhundertkatastrophe», eine “Schmährede“. Das ist falsche Bescheidenheit: Selten hat man in so konzentrierter Form in deutscher Sprache lesen können, was der vor allem von den USA propagierte Neoliberalismus in Wirklichkeit ist und zu wessen Glück und zu wessen Unglück er sich ausbreitet. Zugegeben, so kurz ist der folgende Text auch wieder nicht, aber er ist sehr lesenswert! (cm)
Kurze Zusammenfassung (Abstract)
Der Neoliberalismus bzw. Marktradikalismus ist eine Ideologie, die sich als (Natur-)Wissenschaft gibt und die von ihm propagierte individuelle Freiheit zugunsten eines marktfundamentalistischen Weltbildes durch die Hintertüre abschafft. Es ist eine Ideologie und ihre Protagonisten eine Sekte, welche sich auf Menschen, demokratische Gesellschaften und die natürliche Umwelt zerstörerisch auswirkt, dies jedoch damit zu rechtfertigen versucht, noch nie dagewesenen materiellen Wohlstand zu schaffen – allerdings ohne zu fragen, ob die Menschen diesen tatsächlich als das Glück ihres Lebens betrachten und ob sie bereit sind, den Preis dafür zu bezahlen. Der Marktradikalismus ist nicht der Hort der Freiheit, als der er sich propagandistisch verkauft, sondern der Leviathan, der allmächtige Diktator, der uns mit aller Kraft in seiner sozialdarwinistischen (Tier-)Welt gefangen nehmen will: Alles Recht den Plutokraten dieser Welt! Beleuchtet man den ideologischen Gehalt des Neoliberalismus bzw. Marktradikalismus, offenbart sich einerseits sein «nihilistischer Universalismus» – «Alles ist Wirtschaft! Nur der Profit zählt!» -, anderseits seine philosophische Ver(w)irrung.
Zur Herkunft des Neoliberalismus bzw. Marktradikalismus
Der Begriff des Neoliberalismus und seine ersten institutionellen Anfänge gehen auf den US-amerikanischen Publizisten Walter Lippmann (1889–1974) zurück. Besonders bekannt wurde er mit seinem Werk «Public Opinion» (1922). Es gilt als grundlegender Text in den Bereichen Journalismus / Propaganda, Politikwissenschaft und Sozialpsychologie. Lippmann war u.a. Berater von US-Präsident Woodrow Wilson, prägte Begriffe wie „Cold War“ und war ein Kritiker des Kollektivismus einerseits, des Laissez-faire-Liberalismus anderseits. In seinem ebenfalls bekannten Werk «The Good Society» [1937] übte er scharfe Kritik am New Deal sowie an totalitären Ideologien und befruchtete die Bemühungen um eine erneuerte liberale Ordnung.
Eine wichtige Rolle spielte dabei das nach ihm benannte «Colloque Walter Lippmann». Es fand vom 26. bis 30. August 1938 in Paris statt. Organisiert wurde das Treffen vom französischen Philosophen Louis Rougier. Angesichts der politischen und wirtschaftlichen Krisen der Zwischenkriegszeit sowie des Aufstiegs totalitärer Systeme sollte der Liberalismus neu definiert und weiterentwickelt werden. In diesem Kontext entstand auch der Begriff «Neoliberalismus». Angestrebt wurde eine Abgrenzung sowohl zum klassischen Laissez-faire-Liberalismus als auch zu den kollektivistischen Ideologien wie Sozialismus, Nationalsozialismus und Faschismus. Benannt wurde das Colloquium nach Lippmann, weil sein Werk The Good Society [1937] die Grundlage der Diskussion bildete. Halten wir fest: Der Neoliberalismus bzw. Marktradikalismus ist ein Gegenprojekt zu sozialistischen, nationalsozialistischen und faschistischen Ideologien und mithin selber dem Bereich der Ideologien zuzuordnen (und nicht primär demjenigen der Wissenschaften).
Nach Kriegsende, 1947, nahm Friedrich Hayek den Faden wieder auf und gründete im Beisein von bekannten Ökonomen wie Wilhelm Röpke, Karl Popper, Lionel Robbins, Michael Polanyi (der Bruder von Karl Polanyi), Walter Eucken, Fritz Machlup, Ludwig von Mises, Maurice Allais, Milton Friedman und George Stigler die «Mont Pèlerin Society» (MPS). Nicht eingeladen war Walter Lippmann – er galt als zu wenig «prinzipienfest»[i]. Zugegen waren hingegen einflussreiche Journalisten von Le Monde, Neue Zürcher Zeitung, Wall Street Journal, Newsweek, Fortune etc. Mindestens acht Träger des «Nobelpreises für Wirtschaft» (der von der Schwedischen Reichsbank gestiftet wird, cm) lassen sich der MPS zuordnen.
Der stählerne Arm der Mont Pèlerin Society ist ihr Dachverband atlasnetwork.org mit heute 598 Think Tanks u.a. Partnerorganisationen, unter ihnen so bekannte und einflussreiche Namen wie das Cato Institute, die Heritage Foundation, das kanadische Fraser Institute, das britische Institute of Economic Affairs (IEA), dem Margaret Thatcher eng verbunden war, sowie und vor allem auch die Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit (Potsdam).
Der rasche und durchschlagende Aufschwung der Mont Pèlerin Society hat einen wissenschaftlichen, jedoch auch einen ideologischen Grund. Der wissenschaftliche: Der Aufstieg der Marktradikalen bzw. Neoliberalen begann mit der Stagflation, welche in den späten 1960er Jahren einsetzte und in die 1970er hinüberschwappte. In diesem Kontext erwies sich keynesianisches Deficit Spending kontraproduktiv – es begann die große Zeit der Monetaristen der Chicago School, angeführt von Milton Friedman und Karl Brunner. Der ideologische Grund: Der Keynesianismus bzw. dessen Staatsintervention in die Wirtschaft war für die Reichsten der Reichen der USA schon immer ein rotes Tuch. Unter ihrem Druck nutzte Präsident Richard Nixon die damalige Krise auch zum Aufbau eines «rightist counterestablishments» [Gibbs 2024, S. 3-7] und engagierte dazu die MPS. Damit wurden MPS-Neoliberale wie Friedrich Hayek und Milton Friedman zu Policy Makers auf hoher politischer Ebene. Zwar vorgespurt durch Nixon, fand jedoch der entscheidende politische Wandel gemäß Gibbs unter dem Demokraten Jimmy Carter statt: Liberalisierung des Finanzsektors, Deregulierungen im Bereich der Industrie, Sparprogramme auf Kosten des Lebensstandards der Arbeiterschaft, Reduktion des Einflusses der Gewerkschaften, Erhöhung der Militärausgaben. Präsident Ronald Reagan akzentuierte den Rechtsruck, welchen Nixon einleitete, den jedoch mit Jimmy Carter (Präsident von 1977 – 1981) die Demokraten stringent umzusetzen begannen. Ein wichtiger Indikator für die konkreten Auswirkungen dieser neoliberalen Politik: Seit Carters Amtszeit steigen die Produktivitätszuwächse der US-amerikanischen Volkswirtschaft deutlich stärker als die Lohnzuwächse (Stichwort: Einkommens- und Vermögensdisparitäten).[ii] Mit der Aufhebung des Trennbankensystems 1999 zündete mit Präsident Bill Clinton ein weiterer Demokrat den Nachbrenner des Neoliberalismus und Marktradikalismus: Er öffnete die Schleusen der Finanzialisierung und damit der Desindustrialisierung der US-amerikanischen und in der Folge weiterer namhafter westlicher Volkswirtschaften, darunter selbst die hoch industrialisierte deutsche Wirtschaft.
Der Neoliberalismus – ein philosophischer Kurzschluss
Der Neoliberalismus bzw. Marktradikalismus ist das Resultat eines fatalen philosophischen Kurzschlusses: Dieser erklärt sich aus der Tradition des westlichen, christlich-jüdischen Denkens in Dichotomien, d.h. in unauflöslichen Gegensätzen zwischen Schwarz und Weiß, Gut und Böse, von Triebhaftigkeit versus Selbstkontrolle, von Materie versus Geist, von Fühlen gegen Denken, von Egoismus versus Altruismus, von Verdammnis und Erlösung … Der Neoliberalismus beansprucht für sich, es sei ihm gelungen, diese Dichotomie zu überwinden: Die Neoliberalen sehen die (Er-)Lösung im dynamischen Gleichgewicht «des Marktes».[iii] In diesem sind nach ihrem Verständnis die antagonistischen Strebungen der Menschen gegeneinander aufgehoben, sprich: eliminiert. Dass das totale Chaos des eigennützigen Kampfes jeder gegen jeden in die totale Harmonie, d.h. in ein (dynamisches) Gleichgewicht im Markt umschlage, führen die Neoliberalen auf das mirakulöse Wirken einer «unsichtbaren Hand» zurück – dies in missverstandener Berufung auf Adam Smith: Dieser verwendete den Ausdruck der «unsichtbaren Hand» in seinen beiden monumentalen Werken «Theory of Moral Sentiments» (1759) und «Wealth of Nations» (1776) je nur gerade einmal, und dies eher beiläufig, derweil die Neoliberalen ihren ganzen Marktradikalismus auf dieser «unsichtbaren Hand» aufbauen.
Im Weltbild des Neoliberalismus sorgt also eine numinöse – rational nicht erklärbare, nicht messbare, wissenschaftlich nicht haltbare – Fügung in der Form der «unsichtbaren Hand» dafür, dass die egoistischen, eigennützigen, tierischen – «bösen» – Strebungen der Individuen zu einem dynamischen Gleichgewicht im Markt führen. [iv] In diesem Gleichgewicht sehen die Neoliberalen das größtmögliche Gemeinwohl, Harmonie und Frieden, sprich: das schlechthin «Gute», die «Erlösung».[v] Dies deshalb, weil der Nutzen aller Marktteilnehmenden im dynamischen Gleichgewicht des Marktes der maximal mögliche für alle sei und ergo kein Marktteilnehmer mehr das Bedürfnis habe, etwas daran zu ändern – dies immer unter der stillschweigenden Voraussetzung, alle Marktteilnehmenden handelten vollständig rational-eigennützig.
Im vollständigen Wettbewerb aller gegen alle sehen die Neoliberalen die Freiheit des Menschen. Dieser Freiheitsbegriff ist jedoch ein reiner Zirkelschluss – es wird vorausgesetzt, was eigentlich das Ergebnis sein sollte. Die Argumentation der Neoliberalen geht so: Wenn der homo oeconomicus ein rationales Wesen ist – und das setzen die Neoliberalen als Vorbedingung –, glaubt er an die rationale Vernunft des Marktes und unterzieht sich dank seiner rationalen Einsichtigkeit dessen «Gesetzen» aus freiem Willen – der Mensch ist somit bloß frei, wenn er sich dem vollständigen Wettbewerb (dem radikalen, kompromisslosen Eigennutzenstreben), den «Gesetzen des Marktes, d.h. dem Wirken der «unsichtbaren Hand» und dem Postulat völliger Rationalität unterwirft.[vi]
Dies ist ein ungewöhnliches Konzept von Freiheit – es ist ein Konzept der Selbstunterwerfung. Individuelle Freiheit im Sinne der Aufklärung lässt sich gemäß Freiheits-Denkern wie Luther, Hobbes[vii] und Adam Smith allein damit begründen, dass der Mensch nicht nur als «böse» oder nicht nur als «gut» betrachtet wird, sondern als ambivalentes Wesen, das sowohl zum «Guten» wie zum «Bösen» fähig ist. Nur im Spannungsfeld zwischen «Gut» und «Böse» hat der Mensch die Alternativen, sprich: die Freiheit, sich für das eine oder andere zu entscheiden und für diesen Entscheid die Verantwortung zu tragen. Der Neoliberalismus geht einen andern Weg: Er betrachtet den Menschen grundsätzlich als ein eigennütziges, animalisches, ursprünglich «böses», «sündhaftes» Wesen. Die Facette des «Guten», zu dem der Mensch gemäß Luther etc. ebenfalls fähig ist, fällt weg und damit auch das Spannungsfeld zwischen «Gut» und «Böse» und in der Folge auch die Freiheit des Menschen, sich für das eine oder andere zu entscheiden. Für das «Gute» sorgt im neoliberalen Verständnis die «unsichtbare Hand» bzw. deren Ergebnis: «der Markt» im (dynamischen) Gleichgewicht. Die den Menschen nach Auffassung von Luther und Adam Smith bei seinen Entscheiden leitende Instanz, das Gewissen bzw. die Ethik wird im Neoliberalismus dem Menschen entrissen und an «den Markt», an eine externe, über den Menschen stehende Gewalt und Macht delegiert: «The market knows best! Sein Wille geschehe!» Er ist die Instanz des absolut «Guten».
Der Umtriebigste aller Marktliberalen, Friedrich Hayek [2011, S. 80f][viii], machte «den Markt» zu einer diesseitigen, säkularen Religion, d.h. er überhöhte den Markt in die Transzendenz: «Im buchstäblichen Sinne bezieht es [das Transzendente – HA] sich freilich auf das, was weit über unser Verständnis, unsere Wünsche und Zielvorstellungen sowie unsere Sinneswahrnehmungen hinausgeht, und auf das, was Wissen enthält und schafft, das kein einzelnes Gehirn und keine einzelne Organisation besitzen oder erfinden könnte. Deutlich zeigt sich das in der religiösen Bedeutung des Wortes, wie wir das etwa im Vaterunser sehen, in dem eine Bitte lautet: ‘Dein Wille (d.h. nicht der meine) geschehe, wie im Himmel, so auf Erden’ oder in der Evangeliumsstelle, in der es heißt: ‘Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt’ (Joh. 15,16). Aber ein [sic! – HA] noch treffenderes Beispiel für transzendente Ordnung, ein Beispiel, das sich zufällig auf eine rein naturalistische Ordnung bezieht (in dem Sinne, dass sie von keiner übernatürlichen Macht hergeleitet ist), nämlich das der Evolution, kommt ohne den Animismus aus, der in der Religion noch vorhanden ist: den Gedanken, ein einzelnes Gehirn oder ein einzelner Wille (z.B. der eines allwissenden Gottes) könne herrschen und ordnen.» [ix]
Der ganze pseudo-religiöse Glaubens-Wahn, gemäß dem nicht mein Wille geschehe, sondern derjenige des Gottes namens «Markt»… Hayek verlegt jedoch nicht nur «den Markt» in die Transzendenz, sondern auch den «Kapitalismus» bzw. das, was er darunter versteht. Auch ihn betrachtet er als unausweichliches evolutionäres Schicksal und nicht als eine von Menschen gemachte und durch Menschen gestaltbare Institution – für ihn ist er ein Phänomen einer höheren Macht. Walter Otto Ötsch [2019, S. 89]: «Hayek sieht (…) den Kapitalismus als notwendiges und unvermeidbares Ergebnis der kulturellen Evolution der Menschheit, die ‘spontan’ und ohne bewusste Planung eingetreten sei.»
Die Behauptung, «der Markt» und der Kapitalismus seien die Endpunkte der Evolution, ist sektiererisch: Die neoliberale Community wähnt sich im Besitze der unumstößlichen und ultimativen, ergo ewig gültigen, absoluten Wahrheit. Dies ist mit Karl Popper – er war 1947 bei der Gründung der MPS dabei – und dem von ihm geprägten Verständnis von Wissenschaft unvereinbar: Das Wissen – «die Wahrheit» – ist in den Wissenschaften immer vorläufiges Wissen, will heißen: Die Wissenschaften irren sich in einem permanenten Prozess der Wahrheit entgegen. Dies schließen Hayek und die Seinen in Bezug auf «Markt» und Kapitalismus aus.
Der ultimative philosophische Purzelbaum der Marktradikalen
Nun hält der Marktradikalismus noch einen ultimativen dogmatischen Purzelbaum bereit: Wenn «der Markt» – und mit ihm der Kapitalismus – der Inbegriff des «Guten», ja Göttlichen ist, MÜSSEN die Marktteilnehmer ohne Wenn und Aber rein egoistisch handeln und im totalen Wettbewerb jeder gegen jeden kämpfen – sonst kann die «unsichtbare Hand» gar nicht für das «Gute», das Gleichgewicht im «Markt», sorgen. Mit anderen Worten: Der neoliberale homo oeconomicus MUSS und DARF nur rein rational-egoistisch handeln. Dies heißt nichts anderes, als dass der Neoliberalismus das radikale Eigennutzenstreben der Individuen vom ursprünglich «Bösen» in eine Tugend, in eine unerlässliche POSITIVE Handlungs-NORM – in das «Gute» – umdefiniert. Wer nicht eigennützig ist, wer nicht seinen eigennützigen Trieben freie Bahn lässt, schadet dem «Guten», d.h. der «unsichtbaren Hand» und dem Gleichgewicht im «Markt» (und mit ihm dem Funktionieren des Kapitalismus). Mit dieser Umdeutung von «Gut» und «Böse» enthebt der Neoliberalismus den Menschen seiner ethisch-moralischen Ermessenskraft, d.h. seiner Freiheit und Verantwortung – und verbannt ihn auf diese Weise ins Tierreich der vollständigen Instinkt- und Triebhaftigkeit.[x] Für das, was den Menschen zum Menschen macht, seine Stellung zwischen Vergangenheit und Zukunft, seine Offenheit zur Welt, seine Empathie für seine Mitmenschen, seine geistig-kulturelle Dimension, die ihm hilft, die Welt sinnhaft zu strukturieren sowie Recht und Unrecht zu unterscheiden, und sein Streben nach einem Sinn des Daseins jenseits des materiellen Immer-noch-mehr-haben-Wollens, seine Zivilisation und Kultur – für all dies hat es im neoliberalen Weltbild und in der marktradikalen Welt keinen Platz. Dies ist der Preis der «Religion» und Erlösungsideologie im materialistischen marktradikalen Nirwana der Güter und Dienste sowie der kurzfristigen Profitmaximierung, welche die Neoliberalen mit allem heiligen sektiererischen Eifer als Heilsbotschaft über die ganze Welt verbreiten. (Auszeichnung cm)
Indem der Neoliberalismus den ewigen Konflikt zwischen «Gut» und «Böse» zu lösen vorgibt, indem er den Menschen ins Tierreich verbannt – in die Natur, die per se weder «Gut» noch «Böse» kennt –, unterliegt er einem vollständigen naturalistischen Fehlschluss. Letztlich basiert auf diesem auch der Anspruch der Neoliberalen, eine wertfreie naturwissenschaftliche Disziplin zu sein, welche sich auf unumstößlich gültige Marktgesetze analog den Naturgesetzen berufen kann bzw. glaubt, dies tun zu können. Dank weltumspannender Propaganda ist es dessen Propheten auch weitestgehend gelungen, sich mit diesem Allmachtanspruch in den Köpfen der Menschen des 20. und 21. Jahrhunderts festzusetzen und sie im Namen einer gefakten Freiheit zu unterwerfen: Das marktradikale, neoliberale Credo – Wendy Brown [2021] spricht von einer «Denkdroge» – ist uns allen längst in Fleisch und Blut übergegangen und hat uns süchtig gemacht. Ohne uns der neoliberalen Gehirnwäsche bewusst zu sein – Kennzeichen jeder machtvollen Ideologie –, gehen uns Redewendungen wie
«der Markt» (als anonyme, unangreifbare, alles beherrschende Macht)
«Der Markt befiehlt!»,
«Die Gesetze des Marktes zwingen uns, zu…»,
«ewiges Wachstum!»,
«Jeder und jede ist ersetzbar!»,
«Wenn nicht ich es tue (z.B. Waffen produzieren), tut es jemand anders!»,
«Der Markt ist ein Nullsummenspiel – was der andere gewinnt, verliere ich!»,
«Der (wirtschaftliche) Erfolg gibt immer recht!»,
«Unternehmen MÜSSEN Mitarbeitende entlassen…»
«Märkte brauchen (Planungs-)Sicherheit!»
«Gutmensch!» (als Verhöhnung ethischen Denkens und Handelns)
«Gier ist gut!»
«Mehr Freiheit, weniger Staat» (statt: «Mehr Verantwortung, mehr Freiheit!»)
etc. etc.
völlig unreflektiert über die Lippen.
«Der Markt» – der neue Leviathan
Der Neoliberalismus opfert den freien und verantwortlichen Menschen dem Heiligen Gral bzw. dem Leviathan namens «Markt», den die Marktradikalen als etwas zugleich Naturwüchsiges wie Übernatürliches und nicht als durch Menschen gemachte Institution darzustellen versuchen, wie es die Sozialwissenschaften tun. «Dem Markt» vertrauen ein (wie Hobbes soziopathischer?) Friedrich Hayek und seine ebensolchen Jünger mehr als den Menschen aus Fleisch und Blut bzw. Kopf, Herz und Hand, denn letztendlich tragen die Menschen in sich den Kern der Freiheit und Unberechenbarkeit. Dies widerspricht der neoliberalen Konzeption des «Marktes» als völlig berechenbares (Natur-)Phänomen gemäß der Newton’schen Physik – Stichwort: «Gleichgewicht» – diametral. Entsprechend der Newtonschen Mechanik und Naturwissenschaftlichkeit und deren Gesetzmäßigkeiten streben die Marktradikalen danach, auch den Menschen zu einem völlig berechenbaren Naturwesen zu machen, d.h. sie in den – animalischen! -Naturzustand zurückzuversetzen. Dies versuchen die Marktradikalen, indem sie die Menschen mittels psychologischer Anreize und Konditionierungen[xi] in die Arena des «totalen Wettbewerbs» zwingen, in einen Krieg jeder gegen jeden und alle gegen alle, in welchem sie völlig gewissen- und hemmungslos aufeinander losgehen – dies gemäß dem in der Natur geltenden Gesetz des Rechts des Stärkeren. Der Neoliberalismus tut deshalb alles, um dem Starken zum Sieg zu verhelfen – nichts darf die natürliche Selektion behindern! D.h. der Neoliberalismus ist nicht nur ein sozialdarwinistisches Konzept, sondern ein in Umsetzung begriffenes darwinistisches Projekt.
Die Marktliberalen weisen weit von sich, dass sie eine sozialdarwinistische Gesinnung haben, aber ein Blick in ihren (wirtschafts-) politischen Werkzeugkasten verrät sie als blanke Sozialdarwinisten: Sie verfügen über ein ganzes Arsenal von Instrumenten der Umverteilung von unten nach oben, d.h. von den (vielen) Schwachen zu den (wenigen) Starken: (Auszeichnung cm)
Privatisierung
Deregulierung
Reduzierung der Staatsquote
Förderung des freien Marktes
minimale staatliche Eingriffe
Finanzglobalisierung
Begrenzung der Staatsausgaben
Reduktion von Haushaltsdefiziten
steuerliche Entlastung der hohen und höchsten Einkommen
Kampf gegen die Gewerkschaften
Lohndruck
Verfügungsgewalt über die wirtschaftlich und politisch einflussreichen Medien
Finanzierung neoliberaler / marktradikaler Think Tanks, von Lehrstühlen und NGOs
Etc. etc.
Vor diesem Hintergrund spricht der deutsche Politologe Rainer Mausfeld [2018] von einer «neoliberalen Revolution von oben», die – nota bene! – «maßgeblich durch sozialdemokratische Parteien ausgeführt» wurde, so auch in Deutschland ab 1999 mittels «Senkung des Körperschaftssteuersatzes, des Spitzensteuersatzes, der Abgeltungssteuer, Abschaffung der Steuer auf Veräußerungsgewinne, Abschaffung der Erbschaftssteuer für Unternehmenserben, Hartz IV, massive Ausweitung des Niedriglohnsektors, Leiharbeit.» Zu den Machtinstrumenten des Neoliberalismus zählen gemäß Stubbs et al. [2021] auch Institutionen wie IWF, Gatt, WTO, OECD und Weltbank, welche der neoliberalen Funktionslogik gehorchen.
Das rational-eigennützige Jeder gegen jeden und Aller gegen alle, die Reduktion des Menschen auf einen gewissenlosen, eigennützig-rationalen Mummenschanz namens homo oeconomicus, die Eliminierung jeglicher Freiheit und Verantwortung, die Gefangennahme in einer rein materialistischen Welt der Güter und Dienste – der allseits spürbare Zerfall der Solidarität in den westlichen Gesellschaften ist die neoliberale Selffulfilling prophecy im fortgeschrittenen Stadium ihrer Erfüllung. Die Ikone des Marktradikalismus, Margaret Thatcher [1987], hat das Programm in einem legendären Statement auf den Punkt gebracht: «So etwas wie Gesellschaft gibt es nicht, es gibt nur Männer, Frauen und Familien!»[xii]. Ein ganzes ökonomisches, politisches und gesellschaftliches Weltbild auf dem rational-eigennützigen homo oeconomicus aufzubauen, ist eine gesellschaftszersetzende Doktrin: Die Gesellschaft besteht demnach bloß aus solipsistischen Monaden, die sich zwecks ökonomischen Austauschs zusammenfinden und dann – nach Abschluss des «Geschäfts» – wieder trennen. Und nicht nur für die Ökonomie selber, sondern für alle Lebensbereiche haben die Marktradikalen eine Ökonomie bereit: Ökonomie des Verbrechens, der Familie, der Gesetzgebung, der Politik, der Religion, der Gesundheit, der Bildung, der Familie, der Charity, des Glücks, der romantischen Beziehungen, der Liebe … ganz nach Brecht: «Von der wahren Liebe zur Ware Liebe»; es gibt keine Provinz des Menschlichen, welche die Marktradikalen in ihrem ökonomistischen Übereifer nicht zu besetzen versuchen – im Falle der Marktradikalen und Neoliberalen handelt es sich allerdings nicht allein um blinden, «fachidiotischen» Ökonomismus, sondern um einen höchst raffiniert konzipierten ökonomischen Alleinherrschafts-, sprich: Totalitätsanspruch.
Der Neoliberalismus – eine Bilanz des Elends und der Zerstörung
Was hat der Neoliberalismus bzw. Marktradikalismus den Menschen und der Welt gebracht? Mit seinem berühmten Aufsatz [Friedman 1970] „A Friedman Doctrine – The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits“, erschienen am 13. September 1970 im New York Times Magazine, liess Milton Friedman, 1976 mit dem „Nobelpreis für Wirtschaft” ausgezeichnet (der kein normaler Nobel-Preis ist, sondern von der schwedischen Reichsbank verliehen wird. cm), das totale marktradikale Profitstreben endgültig von der Leine: Er erklärte das Profitstreben zur obersten Maxime des Unternehmertums: „(…) in a free society (…) there is one and only one social responsibility of business – to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception and fraud.“
War es einst üblich, dass Unternehmen nützliche Dinge wie Socken, Brote, Mobilität etc. machten, so war und ist es nun oberstes Gebot, „Geld zu machen“ – ganz im Sinne von Nixons «rightist counterestablishment» und der hinter ihm stehenden US-Plutokraten. Auf diese Weise löste Friedman die Wirtschaftswelt ideologisch endgültig aus dem Dienst an Menschen und Gesellschaft – aus jener Rolle, in welcher sie seit den Philosophen der griechischen Antike gesehen wurde. Aus der Dienerin der Gesellschaft wurde sie unter dem Regime des Neoliberalismus auch zur Herrscherin der Gesellschaft: Der Sozialdarwinismus gilt unter den Marktradikalen nicht bloss als Gestaltungsprinzip der Wirtschaft, sondern aller Lebensbereiche, also auch der Gesellschaft und der Kultur.
2011 bilanzierten Mark Kramer und Michael E. Porter[xiii], Letzterer ein weltbekannter Wirtschaftslehrer an der Business School der Harvard University und selbst ein, wenn auch selbstkritischer Neoliberaler, 40 Jahre Neoliberalismus folgendermaßen: „(…) In recent years business increasingly has been viewed as a major cause of social, environmental, and economic problems. Companies are widely perceived to be prospering at the expense of the broader community. (…) The legitimacy of business has fallen to levels not seen in recent history. (…) A big part of the problem lies with companies themselves, which remain trapped in an outdated approach to value creation. (…) They continue to view value creation narrowly, optimizing short-term financial performance in a bubble while missing the most important customer needs and ignoring the broader influences that determine their longer-term success.“ Wozu dies führte und immer noch führt, welche Schäden die Massenvernichtungswaffen der Wall Street – der „War room“ der Neoliberalen – verursachen, lassen die folgenden Beispiele erahnen:
Chemiekatastrophe von Bhopal (Indien), 1984: Je nach Schätzung starben aufgrund eines Gasaustritts in einem von der US-amerikanischen Union Carbide kontrollierten Chemiewerk zwischen 3’800 und 25’000 Menschen. Ursache: Sparen – zwecks Friedman’scher Profitmaximierung – bei den Sicherheitsvorkehrungen.[xiv]
Als in Tschechien die medizinischen Folgekosten des Rauchens stiegen, wurde erwogen, die Tabaksteuern zu erhöhen. Um diese abzuwenden, legte Philipp Morris eine Kosten-Nutzen-Analyse vor, die zeigte, dass der Staat durch das Rauchen mehr einnimmt, als er verliert: Solange Raucher mit einer medizinischen Behandlung leben, verursachen sie dem Staat Kosten. Weil Raucher jedoch früher sterben, spart der Staat unter dem Strich bei den Renten und der Altenpflege mehr als er für die medizinische Versorgung der Raucher aufwendet – Sterben für den Profit [Sandel, 2013, S. 61f].
Boeing Max, 2018/2019: Um im Wettbewerb mit Airbus die Kosten für eine vollständige Neuentwicklung zu sparen, modifizierte das Unternehmen den Dauerbrenner Boeing 737, was sich allerdings negativ auf das Flugverhalten auswirkte. Um dieses zu verbessern, entwickelte Boeing eine Steuerungssoftware (MCAS), die zum Absturz zweier Maschinen führte. 346 Menschen verloren dabei ihr Leben. Boeing hielt eine MCAS-Schulung für die Piloten für unnötig – Sparen und Sterben für den Profit.[xv]
Diese Beispiele stehen für Millionen weiterer Menschen, welche infolge wachsender Einkommens- und Vermögensdisparitäten bzw. Verarmung, aufgrund erbarmungsloser Arbeitsbedingungen, schädlicher Produkte und einer zerstörten Umwelt um des kurzfristigen Profites willen erkrankt oder gestorben sind.
Die Auswirkungen des Neoliberalismus und Marktradikalismus schwappen von der Ökonomie in das Gesellschaftsleben über: Zu denken ist an die Millionen von Menschen, welche sich in der heutigen westlichen Welt nicht mehr zurechtfinden, weil der vom Marktradikalismus inszenierte eigennützige Kampf aller gegen alle den gesellschaftlichen Zusammenhalt untergräbt und die Menschen so sehr voneinander trennt und sie gegeneinander aufhetzt, dass ihnen letztlich auch der Sinn ihres Daseins abhandenkommt. Denn dieser besteht letztlich im Wissen, gut für jemanden oder etwas zu sein, Mensch unter Menschen zu sein und als solcher einen Platz im Leben zu haben, ohne diesen näher begründen zu müssen – zumal nicht mit ökonomischer Nützlichkeit. Die Ideologie des Neoliberalismus bzw. Marktradikalismus, das Konzept der Marktgesellschaft trifft und erschüttert die Menschen bis in ihr Innerstes.
Alle die oben beschriebenen katastrophalen Auswirkungen seiner Ideologie versucht der Neoliberalismus mit wachsendem materiellem Wohlstand zu rechtfertigen, obgleich er schon lange weit über das hinaus produziert, was die meisten Menschen offenbar an Gütern und Diensten zu ihrem Glück wirklich brauchen:
Das Glück der Menschen in der westlichen Welt ist schon lange nicht mehr positiv mit dem BIP-Wachstum, d. h. mit einer steigenden Menge verfügbarer Güter und Dienste korreliert. Nach Mathias Binswanger [2010, S. 28] hat sich in den USA das reale Bruttoinlandsprodukt (die Menge aller im Inland hergestellten Güter und Dienste) pro Kopf seit dem 2. Weltkrieg mehr als verdreifacht, seit 1956 sinkt jedoch der Prozentsatz derjenigen, die sich als „sehr glücklich“ bezeichnen, kontinuierlich; in Japan stieg das BIP seit dem 2. Weltkrieg sogar um das Sechsfache, der Prozentsatz der Menschen, die sich als „sehr glücklich“ bezeichnen, blieb jedoch konstant. Seit den 70er-Jahren gibt es dazu auch Daten aus Europa: Auch hier blieb die Glücksrate trotz steigendem BIP konstant. Es gibt heute in der westlichen Welt keinen positiven Zusammenhang mehr zwischen materiellem Wohlstand und Glücksempfinden. Anders gesagt: Die Wirtschaft produziert im Prinzip weit mehr, als die Menschen wirklich brauchen, um glücklich zu sein – sie produziert an den Menschen vorbei. Dies gemäß Porter/Kramer [2011] auf Kosten von Menschen, Gesellschaft, natürlicher Mitwelt und der Wirtschaftswelt selber.
Der ehemalige Chefökonom der Umweltabteilung bei der Weltbank, Herman Daly, kommt zum Schluss, das heutige Wirtschaftswachstum sei ein Überschießen, dessen Umwelt- und Sozialkosten höher seien als der Nutzen der Produktion. Es schade der Gesellschaft mehr, als es ihr helfe [Klingholz 2014, S. 70].
Der Marktradikalismus verdammt die Menschen zum materiellen Güter- und Dienstleistungsglück, ohne sie je gefragt zu haben, ob sie dies auch wollen, und wieviel, ob dies wirklich ihr Glück ist und ob sie bereit sind, den Preis dafür zu bezahlen. In Jeremy Bentham (1748 – 1832), einem Utilitaristen, welcher am Anfang der Entwicklung zum heutigen Neoliberalismus steht, sah Peter F. Drucker einen der „gefährlichsten aller liberalen Totalitaristen, welcher tausend Ideen hatte, die Welt um ihres eigenen Guten willen zu versklaven“ [Malik 2004, S. 32]. Daran hat sich bis heute nichts geändert: In den Personen von Thaler und Sunstein will die heutige Verhaltensökonomik «den Individuen zu einem längeren und gesünderen Leben verhelfen»[xvi] – was die Individuen, denen geholfen werden soll, selber darunter verstehen, bleibt jedoch ungeklärt – die Welt in den Händen der Ideologie einer Sekte, welche die Menschheit zu einem Glück zwingen bzw. verdammen will, das nur sie für Glück hält …
Seit 1873 war der Ökonomie bekannt, dass sich Glück nicht willentlich anstreben, nicht herbeizwingen und somit auch nicht als abhängige Variable in ihren Glücks- und Nutzen-Kalkülen verwenden lässt: John Stuart Mill (1806 – 1873) hat es in seinem Vermächtnis, in seiner Autobiographie, erschienen in seinem Todesjahr 1873, festgehalten: «Ask yourself whether you are happy, and you cease to be so. The only chance is to treat, not happiness, but some end external to it, as the purpose of life.” [Mill 1952 (1873), S. 120f] – Will heißen: Wer dem Glück nachjagt, dem rennt es davon! Die Neoliberalen und Marktradikalen versuchen es bis heute zu erhaschen – um jeden Preis …
Die Wirtschaftswelt wieder vom Kopf auf die Füsse stellen!
Wie finden wir wieder aus der so menschen- und gesellschaftsfeindlichen neoliberalen Tretmühle des paternalistisch, ja diktatorisch verordneten (Un-)Glücks heraus? Grundsätzlich geht es darum, die Wirtschaftswelt wieder vom Kopf auf die Füsse zu stellen, d.h. sie aus dem nihilistischen Selbstzweck des Primats der Profitmaximierung (vgl. Milton Friedman) zu befreien und wieder in den Dienst an Menschen und Gesellschaft zu stellen, indem die Unternehmenswelt das produziert, was für diese von Nutzen ist. Dies erfordert, dass sich die Unternehmenswelt wieder von außen, von den Bedürfnissen der Menschen und der Gesellschaft her definiert und nicht von innen (von ihrem einzigen und eigennützigen Ziel der Profitmaximierung her) nach außen. Aus dieser Perspektive ist das von Jim Clemmer [2017] so genannte „Profit-Paradox“ alles andere als paradox:
„That’s the paradox to be managed; companies that exist only to produce a profit don’t last long. And companies that don’t pay attention to profits can’t exist to fulfill their long-term purpose. Pursuing profits without a higher purpose or pursuing a purpose without profit are equally fatal strategies. These aren’t either/or positions to choose between. They’re and/or issues to be balanced. We need to get them in the right order. Many studies have shown that profits follow from worthy and useful purposes. Fulfilling the purpose comes first; then the profits follow. Profits are a reward. The size of our reward depends on the value of the service we’ve given others.“
Mit anderen Worten: Steuere die Ursachen des Erfolgs, nicht den Erfolg selber! Eine unternehmerische Selbstverständlichkeit, welche der neoklassische Neoliberalismus völlig in Vergessenheit geraten ließ – geraten lassen wollte im Zeichen eines sozialdarwinistischen Freiheitsbegriffs, der die Freiheit einiger weniger auf Kosten der vielen meint. Eine Welt, in welcher die Armen und Elenden mit ihrer Armut und ihrem Elend gefälligst zufrieden zu sein haben – sie haben sie ja nach neoliberalem Verständnis selber verschuldet – und in welcher dem Immer-noch-mehr-haben-Wollen der wenigen Reichen keine Grenzen gesetzt werden dürfen, weder materielle noch ethische. Dieser Umgang mit den Armen und Elenden, ihre Demütigung und ihre Hoffnungslosigkeit sind das Einfallstor für den Rechtspopulismus beinahe überall in der westlichen Welt: Er rüttelt teilweise heftig an den Machtpositionen der Neoliberalen, allerdings besitzt er selber auch neoliberale Facetten, nicht zuletzt sozialdarwinistische. Das von den Neoliberalen nach dem Zusammenbruch der UdSSR voreilig ausgerufene Ende der Geschichte findet nicht statt, vielmehr könnte es sein, dass auch der Neoliberalismus sich seinem Ende nähert – gefangen in seinen eigenen menschen- und gesellschaftsfeindlichen Dogmen. Die Geschichte geht weiter – der Geist des Menschen, der Geist der Freiheit und Verantwortung wird sich immer wieder Bahn brechen: «Markt» und Kapitalismus, so wie die Neoliberalen und Marktradikalen diese interpretieren, sind nicht das Ende der Evolution und der Geschichte.

Zum Autor Heinrich Anker:
Heinrich Anker (* 1952) absolvierte zunächst eine Berufslehre als Journalist und Reporter bei einer schweizerischen Tageszeitung. Danach studierte er an der Universität Bern Geschichte, Soziologie, Medienwissenschaften und schloss sein Studium mit einem Master in Volkswirtschaftslehre ab. Danach arbeitete er beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Schweiz im Bereich der empirischen Sozialforschung (Publikumsforschung und Programmentwicklung), worüber er auch seine Dissertation verfasste und in verschiedenen Fachzeitschriften publizierte. Seit 2008 ist er im Bereich der Unternehmenskultur-Analyse und -Entwicklung tätig und arbeitet auf diesem Fachgebiet auch als Hochschuldozent und Autor. Seine wichtigsten Publikationen:
Die Radionutzung 1975 bis 1992 im Spiegel der Publikumsforschung der SRG, Verlag Sauerländer, Aarau, 1995.
Fussnoten:
[i] Für ihn waren nicht nur der Sozialismus und Nationalsozialismus ein Problem, sondern auch der Laissez-faire-Liberalismus. Lippmann stand vorbehaltlos ein für Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, derweil die Neoliberalen die Freiheit (vordergründig) über alles andere stellen. Zudem lehnte er staatliche Interventionen in der Wirtschaftswelt nicht radikal ab.
[ii] In den USA stiegen die wirtschaftlichen Produktivitätszuwächse und die Löhne von 1948 bis 1980 parallel, danach entkoppelte sich die positive Korrelation zwischen Produktivitätszuwächsen und Löhnen: Erstere stiegen zwischen 1979 und 2021 deutlich stärker (+64.6%) als Letztere (+17.3%). Vgl. dazu Gibbs, David N. [2024, S. 2].
[iii] «Den Markt» gibt es realiter nicht. Er ist ein abstraktes Konstrukt der Neoliberalen bzw. Marktradikalen. Deshalb wird er in diesem Essay in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt.
[iv] Für die Neoliberalen war es wie für die Physiker die Entdeckung des Higgs-Teilchens, des «Gottesteilchens», als 1954 der französisch-amerikanische Mathematiker und Ökonometriker Gérard Debreu zusammen mit Kenneth Arrow [Arrow, Debreu, 1954, S. 265–290] in der Fachzeitschrift Econometrica das Paper Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy publizierte. Dafür erhielt Debreu 1983 auch den „Nobelpreis für Wirtschaftˮ. Was bedeutete dieses Paper? Es liefert einen rein mathematischen – im Gegensatz zum Higgs-Teilchen von jeder Empirie freien – rein formalen Nachweis, dass sich unter Wettbewerbsbedingungen bzw. unter der Bedingung der konsequenten Eigennutzen- und Profitmaximierung der Individuen ein dynamisches Gleichgewicht – ein Pareto-Optimum – einstellen kann. Für die Neoliberalen war der Aufsatz von Debreu und Arrows so etwas wie ein „Gottesbeweis“: Es gibt die „invisible hand“ und sie sorgt dafür, dass die individuellen Handlungen aller Marktteilnehmer nicht im Chaos münden, sondern zu einem Gleichgewicht führen können.
[v] Dogmengeschichtlich ist dies von eminenter Bedeutung. Die absolutistischen Königshäuser argumentierten im Rückgriff auf Thomas Hobbes, ohne ihr absolutistisches Walten bräche das totale Chaos aus, die Menschen würden sich in ihrer tierischen Gier zerfleischen. Dem hielt Adam Smith entgegen, der Mensch werde zwar auch von eigennützigen Strebungen motiviert, aber in Form der Empathie (Adam Smith sprach von Sympathy, verstand darunter jedoch das, was heute als Empathie verstanden wird) und des Gewissens (der «impartial inner spectator») besitze jeder Mensch in sich selber auch eine Gegenkraft (gewissermassen einen inneren Polizisten), welche die eigennützigen Strebungen moderiere und kontrolliere, denn es sei ein grundlegendes Bedürfnis aller Menschen, gemäss dem Prinzip der Empathie von den Mitmenschen als ehrenwert, als «praiseworthy», respektiert zu werden. Gemäss Adam Smith ist der Mensch ein intrinsisch-selbstgesteuertes, sich selber beherrschendes Wesen. Deshalb benötigten die Menschen keine übergeordnete, absolutistische Herrschaft, keinen Leviathan, sondern könnten in Freiheit und Eigenverantwortung miteinander interagieren – ohne dass das Chaos ausbreche. Dies ist die Kern-Essenz des Liberalismus. Die sog. Neo-«Liberalen» sehen dies ganz anders: Der Mensch ist – wie bei Hobbes und im Absolutismus – ein eigennütziges Tier. Die Gegenmacht dazu sehen die Neoliberalen im Gegensatz zu Adam Smith nicht im Innern des Menschen selbst angelegt, sondern für sie ist «der Markt» eine aussenstehende, extrinsische, über dem Menschen stehende Macht, das externe Korrektiv zu den tierischen Regungen des homo oeconomicus – «der Markt» als eine quasi-naturwüchsige Gewalt wie die Schwerkraft, der sich niemand entziehen kann. Wo bleibt da Raum für die Freiheit und Verantwortung des Menschen? Die einzige «Freiheit» im Neoliberalismus ist, sich dessen «Markt» bzw. dessen «Gesetzen» zu unterwerfen oder sich ihnen zu verweigern. Aber eine Verweigerung ist nach neoliberaler Lesart gar nicht möglich, weil nach Meinung der Marktliberalen sämtliche Bereiche des Lebens der Menschen nach neoliberal-ökonomischen Prinzipien gesteuert werden – das ganze Leben ist Ökonomie! Der neoliberalen Welt kann sich somit niemand entziehen, es sei denn zum Preis seines Untergangs – das ist TOTALITARISMUS, d.h. die Antithese zum LIBERALISMUS, zu Freiheit, Demokratie, Menschenrechten und unveräusserlicher Menschenwürde. Der Neoliberalismus versteht sich als Projekt der Freiheit gegenüber Sozialismus und Faschismus, kassiert aber diese Freiheit gleich wieder – in der Form des Neoliberalismus ist der LEVIATHAN wieder zurückgekehrt. Vgl. dazu auch Anker, Heinrich [2024]: Vom amerikanischen Traum zum amerikanischen Albtraum. Wie der neoklassische Wirtschaftsliberalismus Menschen, Gesellschaft und Demokratie zerstört. Das Beispiel USA, Novum, o.O., S. 81 – 135.
[vi] Die heutige Verhaltensökonomik betrachtet das neoliberale Ideal der völlig rationalen Entscheidung zwecks Maximierung des Eigennutzens als unrealistisch – menschliche Entscheide können gemäss Verhaltensökonomik fehlerhaft sein. Jedoch: Die Verhaltensökonomik sieht ihre Aufgabe darin, Techniken zu entwickeln, um die Menschen mittels Nudging – mittels Anreizen – an das neoliberale Ideal der vollständigen Rationalität der Eigennützigkeit heranzuführen. Dieses bleibt eine der tragenden Säulen des Marktradikalismus bzw. Neoliberalismus. Vgl. Klonschinski, Andrea, Wündisch, Joachim [2016]: „Präferenzen, Wohlergehen und Rationalität – Zu den begrifflichen Grundlagen des libertären Paternalismus und ihren Konsequenzen für seine Legitimierbarkeitˮ, in: Zeitschrift für praktische Philosophie, Band 3, Heft 1, 2016, S. 599-632, S. 614f. Wer mit Nudging bzw. Anreizen operiert, sieht im Menschen einen Reiz-Reaktions-Mechanismus, nicht ein Vernunft-Wesen. Die liberale Demokratie beruht jedoch auf dem Menschen als Vernunftwesen, selbst wenn dies nur ein Ideal oder sogar bloss eine Fiktion sein sollte. Das neoliberale Konzept von Anreizen und Nudging steht dazu grundsätzlich im Widerspruch: Es sieht vor, die Menschen gewissermassen hinter ihrem Rücken zu einem bestimmten Verhalten zu veranlassen, d.h. sie zu ihrem Glück zu zwingen – das ist Paternalismus. Das Konzept «Demokratie» wird dadurch grundsätzlich in Frage gestellt.
[vii] Hobbes war einer der Ersten, welche den Individuen naturrechtliche Freiheiten zusprachen, d.h. das Recht auf Freiheit des Menschen «von unten» – von den Menschen her – und nicht «von oben» – d.h. nicht in Abhängigkeit vom Goodwill irgendwelcher autokratischen Autoritäten – begründeten. Dass er im Menschen des Menschen Wolf sah, der, wenn er überleben will, seine individuelle Freiheit an den übermächtigen Leviathan delegieren muss, um nicht von den andern Wölfen gefressen zu werden, dürfte auf Hobbes’ höchst ängstliche, depressive, auf Ordnung fixierte Persönlichkeit zurückzuführen sein sowie möglicherweise auch auf die Entsetzlichkeiten des 30-jährigen Krieges 1618 – 1648. Sein Ruf nach dem Leviathan – sein Werk «Leviathan» wurde 1651 veröffentlicht -, der ihn zu einem der Vordenker des Absolutismus machte, soll ihm nicht leicht gefallen sein, weil er den Menschen nicht nur als «schlecht» – als wölfisch gewalttätig – verstand, sondern auch als «gut». Dies die Verwandtschaft mit Luther und dem ebenfalls protestantischen schottischen Presbyterianer Adam Smith, welche auch von einem ambivalenten Menschenbild ausgingen.
[viii] Die textlichen Auszeichnungen im zitierten Text stammen von Hayek.
[ix] Die Neoliberalen verehren «den Markt» und seine Preise als „Entdeckungsverfahren“: „Es reicht aus, dass sich die Menschen frei, im Rahmen ihres Wissens und innerhalb ihres Umfeldes an sich ändernde ökonomische Umstände anpassen. In welcher Weise sie das tun sollten, können sie an der Veränderung der Preisrelationen ablesen. Ein Produzent beispielsweise braucht nicht zu wissen, wieso ein für ihn relevanter Rohstoff vom anderen Ende der Welt teurer wird. Es reicht, dass er die Tatsache zur Notiz nimmt und seine Nachfrage drosselt oder verschiebt (…).“ «Der Markt» als rein mechanische Reiz-Reaktions-Maschine, in welcher jegliche individuelle Verantwortung bezüglich der Folgen des eigenen Wirtschaftshandelns ausgeklammert sind – und damit auch jede Freiheit. Vgl.dazu Horn, Karen [2013]: „Friedrich August von Hayek: Wider die Anmassung von Wissen“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 12.10.2013, Quelle: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftswissen/die-weltverbesserer/friedrich-august-von-hayek-wider-die-anmassung-von-wissen-12605023.html, Download: 27.01.2022.
[x] Nach Jack Hirshleifer [1980] maximiert der Mensch seinen Eigennutzen, wie es alle anderen Lebewesen – seiner Meinung nach – auch tun, z. B. Goldfische, Bienen etc. Im Gegensatz dazu zeichnet sich der Mensch gemäss der philosophischen Anthropologie (Scheler, Plessner, Gehlen, Gadamer, Sartre, Heidegger…) dadurch aus, dass er im Unterschied zum Tier nicht vollständig durch seine Triebe und Instinkte determiniert ist. Der im Gegensatz zu den reinen Naturwesen nicht determinierte Bereich des Menschen ist derjenige des Geistes. Im Bereich des Geistes ist der Mensch nicht dem Reiz-Reaktions-Schema der Naturwesen unterworfen. Der homo oeconomicus des Neoliberalismus ist jedoch ein blosses Reiz-Reaktions-Wesen. In diesem Sinne machen die Neoliberalen den Menschen zum Tier. In diese Richtung weisen auch die Topoi «Anreize» und «Nudging»: Sie gehorchen dem Konditionierungsprinzip des Pawlow’schen Hundes: Der Mensch als ein wie Tiere dressierbares – und demnach völlig berechenbares – Wesen.
[xi] Ein zentrales Reiz-Reaktions-System läuft a) über die Status-Thematik: «Das Leben ist ein dauernder Kampf, wenn du nicht mitkämpfst, bis du ein Versager!», «Wer nicht glücklich ist, ist selber schuld!», «Den Erfolgreichen gehört die Welt!», «Marken machen Menschen!», „Ein echter Mann pflanzt einen Baum, zeugt einen Sohn und fährt einen Jaguar», «Mittellose sind Versager oder Faulpelze»…, b) über Habitus und Distinktion (Besitz). Ein weiterer Strang läuft über c) das Provozieren von Ängsten z.B. um den Arbeitsplatz: Entlassungen, Druck auf die Mitarbeitenden mit Hilfe permanenter Reorganisationen, systematische Geringschätzung der Mitarbeitenden, militärisch-straffe Organisation (einerseits die Ränge der Officers – der Offiziere -, anderseits die Soldaten, sprich: das Heer der Mitarbeitenden, Strategie wörtlich: Kriegführung…), Zerschlagung gewerkschaftlicher Organisationen, völlig überrissene Löhne der Unternehmensspitzen als Zeichen ihrer Allmacht einerseits, der Minderwertigkeit der Mitarbeitenden anderseits, das Wecken von Ängsten, etwas zu verpassen, zu kurz zu kommen, z.B. mittels künstlicher Verknappungen (vgl. de demütigenden Black Friday-Schlachten). Alle diese Massnahmen wirken nicht nur auf der Ebene der wirtschaftlichen Lage der Betroffenen – sie reichen viel tiefer bis in das Selbstverständnis und den Selbstwert der Menschen: Die implizite Botschaft ist immer diejenige, dass die Würde des Menschen sich letztlich nur in seinem ökonomischen Sein, in seiner Arbeits- und Konsumkraft – sprich: «wirtschaftlichen Nützlichkeit» – begründet. Die Ursehnsucht des Menschen qua Mensch ist jedoch, sein Dasein nicht irgendwie begründen zu müssen, zumal nicht mit ökonomischer «Nützlichkeit», seine Sehnsucht, bedingungslos und voraussetzungslos Mensch unter Mensch sein zu können, bedingungslos und voraussetzungslos einen Platz in dieser Welt und in diesem Leben zu haben. Demgegenüber arbeitet sich der Marktradikalismus in immer mehr Provinzen des Menschlichen und des Menschen vor – bis hin zu einer Ökonomie der Liebe. Wohin es führt, die Menschen allein nach dem Kriterium ihres ökonomischen Wertes zu beurteilen, ist nicht zu übersehen: Auf die abschüssige Bahn von «unwertem Leben». Diese Drohung ist ein unbewusster ständiger Begleiter der Menschen der neoliberal-kapitalistischen Welt – einer ihren Motoren. Dieser Motor motiviert nicht positiv, sondern in Richtung Vermeidungsstreben, Angst und Aggression, ja Hass. «Der Markt» ist letztlich destruktiv, ein dauernder Kampf ums Dasein – das Gegenteil der von den Neoliberalen beanspruchten Erlösung. Der dauernde Kampf ums Überleben, der dauernde Krieg als unabwendbares Schicksal – die Überschneidungen zwischen diesem rechtsextremistischen Weltbild und dem Neoliberalismus/Marktradikalismus ist unübersehbar.
[xii] Thatcher soll sich in ihren Memoiren beklagt haben, dieses Statement sei missbraucht worden, sie sei falsch interpretiert worden. Im Kontext des Neoliberalismus kann es jedoch schwerlich falsch interpretiert werden, es verweist jedoch darauf, wie schwierig bzw. unmöglich es für die Marktliberalen ist, aufgrund ihres rational-eigennützigen homo oeconomicus das Phänomen «Gesellschaft» zu begründen. Um dies zu tun, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als zu behaupten, dass das Wirtschaften der Treiber der Kultur ist und nicht umgekehrt. Das würde jedoch u.a. bedeuten, dass im vorkulturellen Urzustand bereits die zu verteilenden Güter vorhanden gewesen sein müssten und nicht die gesellschaftlich-kulturellen Konventionen zu ihrer Erstellung und Verteilung. Viel plausibler ist die Vorstellung, dass soziale Einheiten durch den Zusammenschluss von Menschen entstehen, die gemeinsam etwas erreichen wollen, wozu sie alleine nicht imstande wären. Dies setzt zum einen kommunikative (kulturelle) Einigung voraus, welche Ziele gemeinsam verfolgt werden sollen und auf welche Weise – hier sind (soziale) Absprachen über die Rollenverteilung involviert -, zum andern die Einigung, wer welchen Anteil an diesen gemeinsamen Errungenschaften haben soll – spätestens hier kommen auch soziale Machtfragen ins Spiel. Kurz: Bevor etwas erarbeitet und verteilt wird, laufen komplexe kulturell-zivilisatorische Prozesse ab. Die Erstellung von Gütern ist dabei nur einer von vielen Bereichen, auf welche sich solche Prozesse beziehen – im Urzustand geht es um die Definition von Rollen und deren Verteilung, Einigungen über Machtverteilung und Führung der Gruppe, Jagd und Ernte, positive und negative Sanktionen, Rites de passage, Schutz und Verteidigung der Gruppe gegenüber Angriffen von aussen, Pflege und Aufzucht des Nachwuchses, religiöse Riten, Beziehungen zur Transzendenz, genetischen Austausch mit andern Gruppen und last but not least Tausch innerhalb der Gruppe und Handel mit andern Gruppen als einer unter vielen Bereichen des gesellschaftlich-kulturellen Lebens. Es ist unplausibel, die Entstehung von Kultur und Zivilisation auf den ökonomischen Tausch zurückzuführen – mit dieser Evolutionstheorie zäumt Hayek das Pferd vom Schwanz auf. Dieser Irrtum passiert dann, wenn man alle Phänomene des Lebens und der Kultur allein aus ökonomischer Perspektive betrachtet – dies ist Ökonomismus, der bei den Neoliberalen und Marktradikalen in Reduktionismus (der homo oeconomicus als rein eigennützig-rationales Tier) und Determinismus (Pseudo-Naturwissenschaftlichkeit und Pseudo-Naturgesetzlichkeiten, Hypostasierung von «Markt» und Kapitalismus in die Transzendenz) mündet.
[xiii] Porter, Michael E., Mark R. Kramer [2011]: „Creating Shared Value. How to reinvent capitalism – and unleash a wave of innovation and growth“, in: Harvard Business Review, January-February 2011.
[xiv] «Tatsächlich stellte sich heraus, dass der Tank, der die gefährliche Substanz MIC enthielt, eine Zeitbombe war. Die Sicherungssysteme waren entweder demontiert oder nie einsatzbereit. Der MIC-Tank war ausserdem überfüllt. Offenbar hatte es für die Mitarbeiter von Union Carbide auch keine vernünftige Sicherheitsausbildung gegeben. Als die Gaswolke aus dem Überdruckventil trat, wurde nicht einmal die Alarmsirene angeschaltet, um die Bevölkerung zu warnen. ‘Die Ursache für die Katastrophe war totale Vernachlässigung. Überall nur Vernachlässigung. Und wir haben in einem so gefährlichen Werk gearbeitet.’» Quelle: Deutschlandfunk [2014].
[xv] Gollmer, Philipp [2024]: „Boeing soll sich wegen 737-Max-Abstürzen schuldig bekennen – sonst droht die US-Justiz mit einem Prozessˮ, in: Neue Zürcher Zeitung, 01.07.2024: „Der amerikanische Flugzeugbauer Boeing hat bis Ende Woche Zeit, ein Schuldbekenntnis im Zusammenhang mit dem Absturz von zwei 737-Max-Flugzeugen abzulegen.ˮ, Quelle: https://www.nzz.ch/wirtschaft/boeing-soll-sich-wegen-737-max-abstuerzen-schuldig-bekennen-sonst-droht-die-us-justiz-mit-einem-prozess-ld.1837492, Download: 13.03.2025.
Ein Untersuchungsausschuss des US-Kongresses kam bereits im März 2020 zu dem Ergebnis, bei Boeing habe eine „Kultur des Verheimlichens“ geherrscht.», Quelle: Tagesschau ARD, „Wegen 737-Max-Desaster Milliardenstrafe für Boeingˮ, Stand: 07.01.2021 23:31 Uhr
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/boeing-milliarden-strafe-737-max-101.html
Download 07.01.2022.
[xvi] Qizilbash, M. [2012]: „Informed desire and the ambitions of libertartianism”, in: Social Choice and Welfare 38, S. 647 – 658, 2012, zit. nach Klonschinski, Andrea, Wündisch, Joachim, «Präferenzen, Wohlergehen und Rationalität – Zu den begrifflichen Grundlagen des libertären Paternalismus und ihren Konsequenzen für seine Legitimierbarkeit», in: Zeitschrift für praktische Philosophie, Band 3, Heft 1, 2016, S. 599-632, S. 624. Vielleicht lebe ich kein gesünderes und längeres Leben, wenn ich meiner Lebenspartnerin eine Niere spende, aber vielleicht ein erfüllteres, glücklicheres.
Weitere Literatur von Heinrich Anker
– Vom amerikanischen Traum zum amerikanischen Albtraum. Wie der neoklassische Wirtschaftsliberalismus Menschen, Gesellschaft und Demokratie zerstört. Das Beispiel USA, Novum-Verlag, 2024; (Das Buch ist nicht ganz einfach zu lesen, für Interessierte aber sehr zu empfehlen. cm)
– From the American Dream to the American Nightmare: How neoclassical neoliberalism is destroying people, society and democracy. The example of the USA (e-book), Novum, 2024 ;
– Coévolution, Culture d’Entreprise et Philosophie économique. Au delà du conflit entre l’économie et la société, L’Harmattan, Paris, 2017 ;
– “Die Balanced Valuecard – gesunde Betriebskultur, gesunde Mitarbeiter” sowie «Zur Diagnose und Entwicklung einer gesundheitsfördernden Unternehmenskultur mit der Balanced Valuecard», in: Pirker-Binder Ingrid ((Hg.), Prävention von Erschöpfung in der Arbeitswelt. Betriebliches Gesundheitsmanagement, interdisziplinäre Konzepte, Biofeedback, Springer-Verlag, Berlin / Heidelberg, 2016, S. 53 – 84;
– «The Value Balance in Business – Healthy Corporate Culture, Healthy Employees», sowie «On Diagnosis and Development of a Health Promoting Corporate Culture with the Value Balance in Business”, in: Pirker-Binder, Ingrid (ed.), Mindful Prevention of Burnout in Workplace Health Management. Workplace Health Management, Interdisciplinary Concepts, Biofeedback, Springer International Publishing, 2017, p. 67 – 103;
– Ko-Evolution versus Eigennützigkeit. Creating Shared Value mit der Balanced Valuecard, Erich Schmidt-Verlag, Belin, 2012;
– Wealthier Together. From Maximizing Short-Term Shareholder Value to Coevolution, Open Book Editions / iUniverse Verlag Bloomington IN, 2015;
– Balanced Valuecard. Leistung statt Egoismus, Haupt Verlag, Bern, 2010;
– Der Sinn im Ganzen. Bausteine einer praktischen Lebens- und Wirtschaftsethik, ATE, Münster, 2004;



