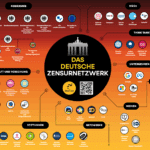„Trump hat die Logik von Putin verstanden“ sagt man in Russland nach dem Alaska-Gipfel
(Red.) Während die meisten westlichen Medien, zum Teil mit Bedauern, zum Teil sogar echt verärgert, Putin als den klaren Gewinner des Meetings Trump/Putin in Alaska vermeldet haben, beurteilt man in Russland das Treffen etwas differenzierter. Positiv aber wird vor allem etwas zur Kenntnis genommen: Die Diplomatie ist zurück, man redet wieder miteinander, Russland wird als geopolitischer Gesprächspartner auch von den USA anerkannt. Stefano di Lorenzo, unser Vertrauensmann in Russland, hat sich genauer umgesehen. (cm)
Das Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump in Alaska am 15. August war schon vor seinem Beginn heftig diskutiert worden. Viele konzentrierten sich doch nicht auf den Inhalt, sondern eher auf die Symbolik. Für einen Großteil der europäischen Presse war die Tatsache, dass Putin in den USA willkommen geheißen wurde, eine Demütigung für Trump, ein Verrat an der Ukraine und an allem, wofür der Westen steht. Das Versprechen von Frieden sei nur eine Täuschung.
In Europa schwankte also die vorherrschende Stimmung zwischen Unglauben und Besorgnis: Wie konnte Trump Putin eine solche Bühne bieten, ohne ihm sichtbare Zugeständnisse abzuringen? Und die Berichterstattung über das Gipfeltreffen in Alaska war vom üblichen „Russlandpessimismus“ geprägt. Aus einem Treffen mit Russland könne niemals etwas Gutes entstehen: Wenn Moskau Zugeständnisse macht, ist das Schwäche; wenn es Widerstand leistet, ist das Aggression; wenn es in einen Dialog eintritt, ist das Manipulation.
Die russische Sichtweise
Viele in Russland hingegen lobten das Treffen zwischen dem russischen und dem amerikanischen Präsidenten als „historischen Moment“. Andere Schätzungen fielen doch auch in Russland gemäßigter und nüchterner aus.
„Putin wollte Trump nicht austricksen“, sagt der russische Politikwissenschaftler Sergei Markow in einem Gespräch mit Globalbridge. „Putin hat Trump einfach seine Logik dargelegt. Der Kern dieser Logik ist ziemlich einfach“, fährt Markow fort: „Sie bieten einen Waffenstillstand an, gut. Aber Sie wissen wahrscheinlich, dass Frankreich und Großbritannien angekündigt haben, am zweiten Tag nach der Verkündung des Waffenstillstands Soldaten und Luftabwehrsysteme in die Ukraine zu schicken. Nach einer möglichen Provokation durch Selenskyj würde Europa in einen Krieg mit Russland hineingezogen werden. Aus diesem Grund ist ein Waffenstillstand kontraproduktiv, und wir brauchen keinen Waffenstillstand, sondern ein Friedensabkommen. Wir hatten bereits einen Waffenstillstand, Minsk I und Minsk II, und die Europäer haben uns einfach betrogen. Ich glaube, dass Trump Putins Logik verstanden hat.“
Tatsächlich kommentierte der US-Präsident in einem Beitrag auf dem sozialen Netzwerk Truth Social: „Man hat bestimmt, dass der beste Weg, um den schrecklichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, darin besteht, direkt zu einem Friedensabkommen zu gelangen, das den Krieg beenden würde, und nicht zu einem bloßen Waffenstillstandsabkommen, das oft nicht hält.“
Ein symbolischer Neustart
Für die russischen Staatsmedien war der Gipfel in erster Linie ein Beweis dafür, dass Russland nach wie vor ein unverzichtbarer Pol in der Weltpolitik ist. Pervij Kanal, der wichtigste russische Staatsfernsehsender, widmete seinen Bericht zum großen Teil der Inszenierung des Treffens: dem in Anchorage ausgerollten roten Teppich, den Kampfjets, die das Flugzeug des russischen Präsidenten eskortierten, dem Anblick von Trump und Putin, die sich ein Fahrzeug teilten. Solche Bilder waren genauso wichtig wie Worte. In der Sendung wurde betont, dass der Gipfel „nicht nur zur Lösung des Ukraine-Problems, sondern auch zur Wiederherstellung des Vertrauens zwischen Moskau und Washington beitragen könnte“. Dieser Satz fasst die Ambitionen des Kremls zusammen: Alaska zu einem Symbol der Gleichberechtigung zu machen, zu einem Moment, in dem Russland als gleichberechtigter Gesprächspartner der Vereinigten Staaten von Amerika auftritt und nicht als bedrängte Macht.
Michail Uljanow, Ständiger Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen in Wien, wies westliche Darstellungen der Isolation Russlands zurück. Er bezeichnete die Vorstellung, Russland sei diplomatisch geächtet worden, als „Unsinn“ und betonte, dass das Land niemals die Beziehungen zur Mehrheit der Welt abgebrochen habe und dass nur etwa 12 Prozent der Weltbevölkerung — der euro-atlantische Block — versucht hätten, ein solches Bild zu vermitteln. Der Gipfel in Alaska sei in dieser Lesart ein Beweis dafür, dass selbst Washington inzwischen die Sinnlosigkeit einer Isolierung Moskaus erkannt habe.
Trump und Putin sprachen zweieinhalb Stunden lang, flankiert von ihren außenpolitischen Beratern — Sergej Lawrow und Juri Uschakow auf russischer Seite, Marco Rubio und Steve Witkoff auf amerikanischer Seite. Doch am Ende wurde weder ein Waffenstillstand in der Ukraine vereinbart noch eine Aufhebung der Sanktionen angekündigt noch eine Agenda für wirtschaftliche Zusammenarbeit erwähnt.
Europa außen vor
Ein wiederkehrendes Thema in russischen Kommentaren ist die Marginalisierung Europas: Washington und Moskau sprechen direkt miteinander, während Brüssel gezwungen war, darauf von außen zu schauen und zu reagieren. Dies bestätigte sich auch in den Reaktionen nach dem anschließenden Treffen in Washington zwischen Trump auf der einen Seite und den europäischen Staats- und Regierungschefs sowie dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf der anderen Seite. Trump mag den europäischen Staats- und Regierungschefs versichert haben, dass die Souveränität der Ukraine weiterhin wichtig ist, aber in der Praxis akzeptierte er Putins Argumentation, dass nur eine umfassende Lösung – und nicht ein endloser Zermürbungskrieg – Stabilität bringen könne. Analysten wie Vladimir Suslow von der Moskauer Higher School of Economics bemerkten, dass die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten, eine endgültige Lösung für den Ukraine-Konflikt zu suchen, das wichtigste Ergebnis des Gipfeltreffens in Alaska gewesen sei.
Die Zeitung Wsgljad äußerte sich schärfer. Das Treffen in Alaska habe „politisches Fieber in Europa“ ausgelöst, so die russische Zeitung. Europäische Regierungschefs waren nicht in der Lage, ein gemeinsames Kommuniqué zu verabschieden. Für die russische Zeitung war diese Uneinigkeit ein Beweis dafür, dass die EU zu einem zweitrangigen Akteur geworden ist, der nicht in der Lage ist, eine russisch-amerikanische Annäherung zu verhindern.
Andere wollen den europäischen Faktor nicht vernachlässigen.
„Es ist durchaus möglich, dass Europa schnell aufrüsten könnte, um den Krieg ohne Amerika fortzusetzen“, warnt der Politologe Sergej Markow. „Viele Staats- und Regierungschefs in Europa brauchen diesen Krieg aus internen Gründen. Ich denke, der Krieg wird weitergehen.“
Keine Gewinner, keine Verlierer
Nach ihrem Gespräch traten Trump und Putin kurz vor die Presse, gaben jedoch kaum Details preis. Später deutete Trump jedoch an, dass einige informelle Vereinbarungen getroffen worden seien, und erklärte, dass „es nun an Selenskyj liege“. Dies wurde in Russland als subtile, aber wichtige Konzession interpretiert: Der US-Präsident hatte die Verantwortung für weitere Schritte auf Kiew übertragen und damit angedeutet, dass Washington die Kämpfe der Ukraine nicht mehr bedingungslos führen werde.
„Dieses Treffen sollte nicht danach bewertet werden, wer der Gewinner und wer der Verlierer war. Bei diesem Treffen ging es um etwas anderes“, schreibt das russische Militärportal Topwar. „Aus Sicht der Ziele, die Trump verfolgt, ist es für ihn wichtig, gute Beziehungen zu Russland zu haben. […] Die USA wollen ja nicht, dass sich die Russische Föderation endgültig China unterordnet und damit ihren geopolitischen Gegner stärkt, sondern dass Russland ihre Unabhängigkeit bewahrt. Daher sind die Amerikaner bereit, in der Ukraine-Frage gewisse Zugeständnisse zu machen. Russland ist einer Normalisierung der Beziehungen zu den USA nicht abgeneigt, aber angesichts dessen, was in der Vergangenheit passiert ist, wird niemand diesmal Gesten des guten Willens machen.“
Der Kreml besteht darauf, dass nur ein umfassendes Abkommen, das die NATO-Erweiterung, Sicherheitsgarantien und die Neutralität der Ukraine regelt, echte Stabilität bringen kann. Alles andere wäre nur eine Pause vor einem erneuten Konflikt. Der Gipfel in Alaska war also nur ein Anfang, kein Abschluss.
Diese Dualität – Erfolg auf kurze Sicht, Unsicherheit auf lange Sicht – prägt die russischen Reaktionen. Für die heimische Öffentlichkeit konnte Alaska als diplomatischer Sieg dargestellt werden. Für die strategischen Planer in Moskau ist jedoch noch alles offen: Russland hat Anerkennung gewonnen, aber es fehlt noch immer eine verbindliche Einigung, und Europa und die Ukraine könnten die Bedingungen eines „Deals“ zwischen den USA und Russland ablehnen.