
Essay | Frieden teilen – Das Machtgleichgewicht als Motor der Geschichte
Über drei Jahrzehnte lang schien der Westen Sieger der Geschichte zu sein. Der Kalte Krieg war vorbei, der Liberalismus weltbeherrschend, die Globalisierung alternativlos. Doch in den Schatten dieser Gewissheiten wuchsen neue Kräfte, alte Muster kehrten zurück. Heute zeigt sich, die Epoche der unipolaren Ordnung war weniger ein Endpunkt als ein Intermezzo – eine Phase, in der Macht nur scheinbar durch Moral ersetzt wurde. Der Politikwissenschaftler Pascal Lottaz nennt sie den „Unipolaren Moment“. Der Dokumentarfilmer und Autor Dirk Pohlmann beschreibt ihre verborgenen Brüche. Momente, in denen Verständigung möglich schien und doch unterging. Gemeinsam zeichnen sie ein Panorama, das von Hoffnung, Verrat und der bleibenden Logik des Machtgleichgewichts erzählt.
Für jene, die Sabiene Jahn lieber hören als lesen, hier anklicken.
Über drei Jahrzehnte lang galt die Zeit nach 1991 als das „Post-Cold-War-Zeitalter“. Der Begriff schien neutral, beschreibend, beinahe selbstverständlich. Doch nun, da sich die geopolitische Lage verschiebt, verliert diese Bezeichnung an Erklärungskraft. Der Politikwissenschaftler Pascal Lottaz schlägt vor, die Jahre zwischen dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Beginn des Ukrainekrieges 2022 als das zu bezeichnen, was sie faktisch waren – den unipolaren Moment (1). Der Ausdruck stammt aus der angelsächsischen Geopolitik. Er beschreibt eine historische Konstellation, in der eine einzige Macht – die Vereinigten Staaten – über so umfassende militärische, ökonomische und kulturelle Dominanz verfügt, dass sie die Spielregeln der internationalen Politik weitgehend allein bestimmt. Dieser Zustand, so Lottaz, war nie stabil, sondern eher eine Übergangsphase. Die kurze Spanne zwischen der bipolaren Ordnung des Kalten Krieges und der nun entstehenden multipolaren Welt (2). Die These folgt einer klassischen Beobachtung realistischer Theoretiker. Unipolarität trägt ihren eigenen Zerfall in sich. Machtkonzentration ruft Gegenkräfte hervor. Die 1990er- und 2000er-Jahre waren daher weniger ein „Ende der Geschichte“ (3) als ein historischer Zwischenton. Erst jetzt, im Rückblick, lässt sich diese Phase als abgeschlossen identifizieren.
Während der Westen nach 1991 versuchte, ein globales Regelwerk auf Basis liberaler Normen und offener Märkte zu etablieren, blieb die materielle Grundlage dieser Ordnung asymmetrisch: Die militärische Überlegenheit der USA. Interventionen in Jugoslawien, Afghanistan, Irak und Libyen galten als Ausdruck eines universalistischen Selbstverständnisses, das Demokratie und Menschenrechte notfalls mit Machtmitteln durchzusetzen bereit war. Doch genau darin lag der Keim des künftigen Umbruchs. Der „Krieg gegen den Terror“, der 2001 begann, schien zunächst ein neues Ordnungsprinzip zu liefern. Doch er veränderte – wie Professor Lottaz betont – nicht die Struktur des internationalen Systems, sondern nur die Agenda. Erst die wachsende Selbstbehauptung anderer Machtzentren – Chinas Aufstieg, Russlands Renaissance, die Herausbildung der BRICS-Kooperation – beendete faktisch den unipolaren Zustand (4). Mit dem russischen Eingreifen in der Ukraine im Februar 2022 wurde diese Entwicklung sichtbar. Zum ersten Mal seit dem Ende des Kalten Krieges existiert eine Koalition bedeutender Staaten, die westliche Sanktionen und Deutungshoheit offen zurückweist. Damit endet der Zeitraum, den Lottaz zwischen Dezember 1991 und Februar 2022 einrahmt: Dreißig Jahre unipolarer Dominanz (5).
Auch andere Begriffe konkurrieren um die Deutung der neuen Epoche „multipolar“, „multinodal“ oder „polyzentristisch“. Hinter den semantischen Nuancen steckt ein gemeinsames Motiv, die Rückkehr der Machtverteilung. Der Westen ist nicht mehr alleiniger Taktgeber, sondern ein Akteur unter mehreren. Diplomaten wie Chas Freeman sprechen von einer „multinodalen Ordnung“, um zu betonen, dass Macht heute nicht nur geopolitisch, sondern auch technologisch, finanziell und kulturell verteilt ist (6). Lottaz’ Reframing ist auch eine Erinnerung daran, dass Begriffe immer nachträglich entstehen. Erst spätere Ereignisse geben früheren Epochen Kontur. Wie der Erste Weltkrieg rückwirkend den „Ersten“ hervorbrachte und die Zwischenkriegszeit erst nach 1939 als solche erkennbar wurde, so wird nun das „Post-Cold-War-Zeitalter“ zum „Unipolaren Moment“. Das hat mehr als nur semantische Bedeutung. Es erlaubt, die vergangenen drei Jahrzehnte als historisches Experiment zu begreifen. Ein Versuch, globale Einheit über westliche Hegemonie zu erzwingen, erfolgreich in der Ausbreitung westlicher Werte, gescheitert an ihrer selektiven Anwendung. Denn während der Westen universelle Prinzipien beschwor, setzte er sie nur dort durch, wo sie geopolitisch opportun erschienen (7).
Viele Beobachter aus Asien, Afrika und Lateinamerika sahen darin keine moralische Führungsrolle, sondern eine Neuauflage kolonialer Vormachtstrukturen. Der Ruf nach Souveränität, Gleichberechtigung und kultureller Eigenständigkeit wuchs. Der „Unipolare Moment“ war damit auch das Zeitalter seiner Erosion (8). Heute wird an seinen Rändern sichtbar, was ihn ablöste: Eine Welt der konkurrierenden Machtzentren – Washington, Peking, Moskau, Neu-Delhi, Teheran, Ankara, Brasilia. Die Dynamik der BRICS-Erweiterung, die Energiepolitik der Golfstaaten und die wachsende Skepsis gegenüber westlichen Finanzinstitutionen deuten auf eine systemische Neuordnung (9). Doch Lottaz schließt seine Analyse mit einer hoffnungsvollen Wendung. Wenn der „Unipolare Moment“ endet, muss nicht zwangsläufig ein „Dritter Weltkrieg“ folgen. Möglich sei auch ein neues Gleichgewicht, eine Art „Concert of Powers“, also ein multilateraler Realismus, der Stabilität nicht mehr aus Dominanz, sondern aus Ausgleich gewinnt (10).
Es ist eine Ironie der Geschichte, dass das Zeitalter der unipolaren Ordnung mit den besten Absichten begann und mit Misstrauen endete. Drei Jahrzehnte lang glaubte der Westen, er habe die moralische und institutionelle Formel für den Rest der Welt gefunden. Doch der Export des eigenen Wertekanons stieß dort an Grenzen, wo er als Instrument der Kontrolle wahrgenommen wurde. Die gegenwärtige Verschiebung zur Multipolarität ist keine Niederlage des Westens – sie ist seine Entzauberung. Die Welt hat gelernt, dass Globalisierung kein Synonym für Gleichheit ist und dass liberale Werte ohne Glaubwürdigkeit nur als Rhetorik wirken. Die Erosion westlicher Deutungshoheit ist daher weniger Folge eines äußeren Angriffs als einer inneren Erschöpfung (11). Die Vereinigten Staaten bleiben eine Supermacht, aber nicht mehr die einzige. Ihr wirtschaftlicher Einfluss ist gebrochen, ihre moralische Autorität beschädigt, ihr diplomatisches Instrumentarium überdehnt. Europa wiederum ringt um eine eigene Stimme, gefangen zwischen transatlantischer Loyalität und dem Wunsch nach strategischer Autonomie. Gleichzeitig entstehen neue Zentren. China mit seinem technologisch-ökonomischen Ehrgeiz, Russland mit seiner sicherheitspolitischen Gegenmacht, Indien mit seinem demografischen Gewicht und der globale Süden mit wachsendem Selbstbewusstsein. Diese Akteure definieren Souveränität neu. Sie kehren der Weltgemeinschaft nicht den Rücken, sie agieren aus dem Anspruch auf Augenhöhe (12).
Wer die Jahre 1991–2022 als „Unipolaren Moment“ neu etikettiert, stößt rasch auf eine unbequeme Beobachtung. Immer dann, wenn europäische oder transatlantische Akteure begannen, Alternativen zur Logik der Blockdominanz praktisch zu erproben, wie etwa Schuldenumstrukturierungen, energie- und sicherheitspolitische Ausgleichskonzepte oder eine Annäherung zwischen West und Ost, traten Kräfte auf den Plan, die solche Kurswechsel stoppten. Nicht immer ist klar, wer die Bremse zog. Doch die Spuren sind deutlich genug, um aus der abstrakten Systemdiagnose konkrete Geschichte zu machen. Das Gespräch zwischen Pascal Lottaz und dem Dokumentarfilmproduzenten und Autor Dirk Pohlmann liefert dafür reiches Material. Fälle, Personen, Entscheidungsaugenblicke, und die Leerstelle, die bleibt, wenn Archive geschlossen und Ermittlungen früh beendet werden (13).
Der Mord an Alfred Herrhausen markiert einen dieser Augenblicke. Ende November 1989, zwei Wochen nach dem Mauerfall, wird der damals einflussreichste deutsche Banker in Bad Homburg durch eine präparierte Sprengladung getötet. Offiziell wird die Tat der „dritten Generation“ der RAF zugeschrieben. Pohlmann widerspricht der verbreiteten These, diese Generation sei nur ein Phantom der Dienste. Er hält sie für real, heterogen, teils verwahrlost, teils ideologisch gefestigt und, entscheidend, aus beiden Richtungen durchsetzt – von ostdeutscher Staatssicherheit wie von westlichen Sicherheitsapparaten (14). Gerade diese Doppelbelichtung wirft die Frage auf, warum eine eng überwachte Gruppe eine Tat solchen Kalibers überhaupt ausführen konnte. Der Hinweis auf „operative Durchlässigkeit“ ist kein Beweis für Steuerung, aber er verschiebt die Beweislast. Wenn der Staat nahezu alles wusste, was wusste er hier nicht?
Die Plausibilität des Motivs liegt, folgt man Pohlmanns Recherchen und zahlreichen zeitgenössischen Reden und Entwürfen, weniger in der Ikone „Banker“ als in Herrhausens Agenda. Er wollte die große Bilanz des Kalten Krieges korrigieren, die Dividende des Entspannungsprozesses produktiv machen. Schuldenrestrukturierungen für die Dritte Welt nicht als Geste, sondern als Programm, eine Managementausbildung und treuhänderische Begleitung für eine postsowjetische Wirtschaft, damit Umbruch nicht Raub wird. Und das, was er – bewusst an Bismarck anschließend – als deutsche Aufgabe verstand, die ökonomische Integration der Sowjetunion in eine europäische Friedensökonomie (15). Nicht als deutscher Sonderweg gegen Amerika, sondern als Arbeitsteilung im gemeinsamen Westen. Doch genau hier kreuzten sich Vision und Geopolitik. Wer Deutschland und Russland im Modus wechselseitigen Vorteils zusammendenken wollte, berührte seit jeher eine rote Linie angloamerikanischer Strategen. Henry Kissinger, erinnert Pohlmann an ein Streitgespräch im Sommer 1989, warnte Herrhausen vor systemischen Konstanten, die Charismatiker nicht aushebeln könnten (16). Öffentlich lautete die Begründung „Vorsicht vor Rückfällen“. Implizit klang das Prinzip, Sicherheitsarchitektur vor Wirtschaftsversöhnung.
Herrhausen war kein Linker, kein Romantiker, sondern ein rationalistischer Pragmatiker mit sozialkatholischer Schlagseite. Gerade deshalb irritierte sein Programm die reflexhaften Zuordnungen. In der extremen Linken wurde die Ermordung gefeiert – der „Kapitalist“ war getroffen. In der linksliberalen Szene blieb Ratlosigkeit. Warum ausgerechnet er? Ein Bankier, der mit Helmut Kohl die Chance erkannte, die Betonblöcke des Kalten Krieges in tragfähige Pfeiler einer neuen Ordnung zu gießen, verschwand – und mit ihm ein Pfad, der seither kaum mehr betreten wurde. Pohlmann berichtet von Stimmen aus dem Umfeld Kohls, die die Tat als Warnung verstanden, die Außenpolitik nicht zu weit in Richtung eigenständiger europäischer Gestaltung treiben zu wollen (17). Offizielle Protokolle belegen diese Lesart nicht. Doch die politische Folge spricht für sich. Die deutsche Einheit blieb fest an die NATO rückgebunden, der Versuch einer gleichzeitigen institutionellen Öffnung nach Osten unterblieb, und die 1990er wurden zur Dekade des westlichen Alleinmanagements.
Das Muster wiederholt sich, in anderen Ländern und Rollen. Olof Palme, schwedischer Premier, ermordet 1986. Ein Sozialdemokrat, der Abrüstung, Blockfreiheit und eine selbstbewusste skandinavische Mittellage dachte, unbequem für beide Seiten (18). Enrico Mattei, Chef des italienischen Energiekonzerns ENI, starb 1962 bei einem Flugzeugabsturz, dessen Ursachen neuere Untersuchungen nicht mehr als Unfall gelten lassen wollen. Mattei brach das Oligopol der „Seven Sisters“, verhandelte Verträge auf Augenhöhe mit dem globalen Süden und stellte die Frage nach nationaler Souveränität in einer amerikanisch dominierten Energieordnung (19). Dag Hammarskjöld, UN-Generalsekretär, kam 1961 bei einer Vermittlungsmission im Kongo ums Leben – bis heute umstritten, ob es sich um einen Unfall oder Anschlag handelt (20). Gemeinsam ist diesen Personen weniger ein politisches Lager als eine Funktion. Sie verschoben die Schwerkraft von Macht weg von geschlossenen Blöcken hin zu Ausgleich, Regeln und geteilten Gewinnen. „Wer Frieden organisiert, berührt Besitzstände“, sagt die Geschichte – und manchmal endet sie tödlich.
Auch der Kennedy-Fall, von Pohlmann ausführlich beschrieben, passt in diese Logik der abgebrochenen Brücken (21). Nach der Kuba-Krise suchte John F. Kennedy, parallel zu Nikita Chruschtschow, die Flucht nach vorn. Teststoppabkommen, eine gemeinsame Mondmission als Wettstreit der Systeme ohne Vernichtung, der Versuch, nukleare Parität durch politisches Vertrauen zu unterfüttern. Nicht alle in Washington und anderswo hielten das für eine weitsichtige Entschärfung. Manche sahen darin eine Unterminierung der eigenen Abschreckungsordnung. Dass Kennedys Tod die härteren Fraktionen stärkte, ist unbestritten, wer den Abzug drückte, bleibt umkämpft. Aber wie beim Blick auf Herrhausen hilft die juristische Unschärfe nicht gegen die politische Klarheit. Jedes Mal, wenn das „System“ – ob unipolar oder bipolar – eine Öffnung ins Spiel brachte, fanden sich Gründe und Akteure, sie zu schließen.
Bis weit in die 1990er Jahre hinein war es in Deutschland nahezu tabu, Geopolitik als treibende Kraft hinter den weltpolitischen Konflikten zu thematisieren. Doch genau hier liegt der Kern. Pohlmann formuliert es unmissverständlich – es ging nie um den Kommunismus – das war nur der Deckmantel. Russland ist heute kein „marxistischer“ Staat mehr, sondern ein konservativ geprägtes, christliches Land. Und dennoch bestehen die gleichen Konfliktstrukturen fort. Damit fällt das ideologische Argument in sich zusammen. Der alte Gegensatz „Demokratie gegen Totalitarismus“ erweist sich als rhetorisches Tarnnetz über einem machtpolitischen Kontinuum. Konstant blieb das Ziel, eine dauerhafte eurasische Verständigung, insbesondere zwischen Deutschland und Russland, zu verhindern. Diese Linie zieht sich, von Bismarck über den Kalten Krieg bis in die Gegenwart, durch die westliche Außenpolitik. Kontrolle des eurasischen Raums durch Spaltung seiner Endpunkte (22). Nicht die Ideologie, sondern das Machtgleichgewicht ist der Motor des Konflikts. In diesem Licht erscheint der „Unipolare Moment“ weniger als Ende des Kalten Krieges, sondern als dessen Neuformatierung: Unter neuem Etikett, aber mit derselben strategischen Grammatik.
Epochen enden selten mit einem Knall, sondern mit einem Verstummen. Man merkt erst später, dass die Töne, die einst Brücken andeuteten, plötzlich fehlten – wie Fragmente eines unvollendeten Satzes. Sie beginnen dort, wo Macht auf Verständigung traf, und brechen dort ab, wo Verständigung zu gefährlich wurde. Die Brüche der Vergangenheit sind der Seismograph der Gegenwart. Wie viel Gestaltung lässt eine Ordnung zu, die sich auf Sicherheit beruft? Und wann wird Sicherheit selbst zum Vorwand, Veränderung zu verhindern? Wenn die Nachwelt diese Fragen erneut stellt, wird sie nicht nur in Archiven, sondern in den Entscheidungen von heute lesen müssen, ob aus Erinnerung politische Vernunft geworden ist oder ob der unvollendete Satz der Verständigung erneut abbricht, bevor er zu Ende gedacht war. Vielleicht liegt gerade darin seine Bedeutung. Er zeigte, wie schwer es ist, Frieden zu verwalten, wenn man ihn allein besitzen will.
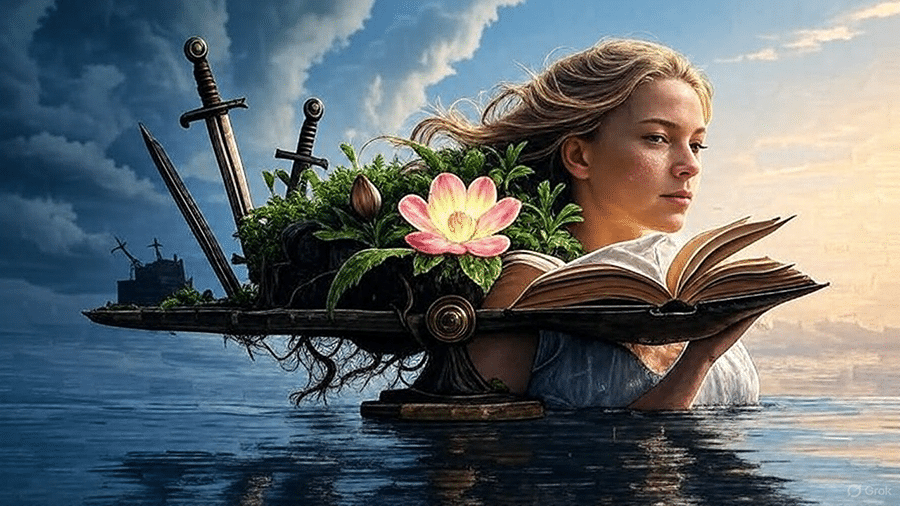
In eigener Sache:
Als Tochter des östlichen Deutschlands trage ich die Erinnerung in mir. Sie ist kein Museumsexponat, das man sorglos beiseitelegt, sondern ein lebendiges Anliegen. Ich erlaube dem westdeutsch hinzugekommenen Teil meiner Geschichte nicht, diese Erfahrung auszulöschen – komme, was wolle. Und ganz offen: Wenn mir jemand eine Waffe in die Hand drücken wollte, so möge er es tun, ich werde sie niemals gegen das russische Volk richten. Vielmehr würde ich mich abwenden und jene, die die Peiniger der Geschichte sind, mit ihr vor die Füße werfen. Das ist ein Prinzip. Gewalt gegen Menschen ist niemals die Antwort auf geopolitische Verblendung. Wohl aber werde ich jede Instrumentalisierung von Leid, jede Verharmlosung historischer Verbrechen und jede Versuchung, die Menschlichkeit dem Kalkül zu opfern, benennen und bekämpfen. In dieser Zeit müssen jene geschützt werden, die sich dem Druck widersetzen, gegen Kontenkündigung, Diffamierung, Berufs- oder Gesellschaftsausschluss, gegen juristische Einschüchterung und Inhaftierung. Viele Menschen sehen dies nicht in Deutschland, aber es geschieht bereits. Und Viele rufen nicht um Hilfe, weil sie glauben, selbst Verantwortung tragen zu müssen. Unterstützen wir die Mutigen. Wir dürfen sie nicht alleinlassen.
Quellen und Anmerkungen:
1.) https://pascallottaz.substack.com/p/the-post-cold-war-is-now-the-unipolar
2.) https://users.metu.edu.tr/utuba/Krauthammer.pdf;
3.) https://dn721609.ca.archive.org/0/items/THEENDOFHISTORYFUKUYAMA/THE%20END%20OF%20HISTORY%20-%20FUKUYAMA.pdf
4.) www.simonandschuster.com/books/The-Future-Is-Asian/Parag-Khanna/9781501196263; eng.globalaffairs.ru/articles/a-new-world-order-a-view-from-russia/; https://eng.globalaffairs.ru/articles/new-world-order-balance-diversity
5.) www.foreignaffairs.com/articles/china/2021-10-19/inevitable-rivalry-cold-war
6.) https://chasfreeman.net/surviving-the-world-order-to-come; https://chasfreeman.net/americas-role-in-a-multipolar-world
7.) https://michael-hudson.com/2022/05/the-destiny-of-civilization/
8.) https://archive.org/details/endofamericanwor0000acha
9.) www.gov.za/sites/default/files/speech_docs/Jhb%20II%20Declaration%2024%20August%202023.pdf;
https://brics2023.gov.za
10.) www.youtube.com/watch?v=PFXO-8TpnfU
11.) www.youtube.com/watch?v=asQurrIoCUI; www.suhrkamp.de/buch/wolfgang-streeck-zwischen-globalismus-und-demokratie-t-9783518429686
12.) link.springer.com/book/10.1007/978-981-16-6811-1; www.ucpress.edu/books/all-under-heaven/english.almayadeen.net/articles/features/geopolitical-paradigm-shifts-and-coping-with-psychopaths
13.) www.youtube.com/watch?v=F2ObAW0sblw
14.) www.derstandard.de/story/3000000209385/das-raetsel-der-dritten-raf-generation
15.) www.youtube.com/watch?v=enc9U2LPXrQ
16.) thomas-riegler.net/2024/09/30/der-banker-und-die-bombe
17.) https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691023434/history-and-strategy
18.) www.youtube.com/watch?v=J5i-DI-rskw; de.euronews.com/2020/06/10/mordfall-olof-palme-staatsanwaltschaft-stellt-ermittlungen-ein
19.) www.youtube.com/watch?v=rhKZVPOGFB4; jonathanrosenbaum.net/2022/06/the-mattei-affair-1975-review-tk/; www.tandfonline.com/toc/rmis20/28/1
20.) www.amazon.de/Who-Killed-Hammarskjold-Supremacy-Africa/dp/1849048029
21.) www.youtube.com/watch?v=o0F0HTegaac
22.) www.youtube.com/watch?v=F2ObAW0sblw



