
Frieden durch Stärke ist eine Lüge: „Si Vis Pacem, Para Bellum“ führt nur zu mehr Krieg!
(Red.) Wer die Ukraine und ihre Geschichte seit 1991 kennt, der weiß, dass es vor allem die von der NATO in der Ukraine betriebene “Interoperability“ – die militärische Zusammenarbeit – war, die Russland veranlasste, im Februar seinerseits militärisch zu intervenieren. Stefano di Lorenzo weist in seinem neusten Text darauf hin, dass militärische Aufrüstung mit dem vermeintlichen Ziel der Kriegsverhinderung meist das Gegenteil bewirkt: den Beginn eines Krieges. Eine äußerst lesenswerte historische Analyse! (cm)
In der internationalen Politik gibt es nur wenige Sprichwörter, die mit solcher Ehrfurcht zitiert werden wie das lateinische „si vis pacem, para bellum“ – wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Es ist eine Maxime, die seit Jahrhunderten militärische Planungen, Wettrüsten und nationale Verteidigungsdoktrinen untermauert. Die Geschichte zeigt jedoch etwas zutiefst Paradoxes, ja sogar Tragisches: Die Nationen, die sich im Namen des Friedens am eifrigsten auf den Krieg vorbereiten, geraten oft wirklich in einen Konflikt. Wenn man Frieden will und sich auf den Krieg vorbereitet, bekommt man in der Regel genau den Krieg, den man vermeiden wollte.
Nirgendwo wird diese Dynamik deutlicher als in der sich langsam abspielenden Katastrophe, die die Ukraine heimgesucht hat. Acht Jahre lang, nach dem Übergang der Krim an Russland im Jahr 2014, bildete die Ukraine ihr Militär aus, baute Allianzen auf und verstärkte still und leise ihre Verteidigung. Die NATO unterstützte diese Bemühungen und bezeichnete sie als „Abschreckung”. Für Russland sah all das jedoch in der Hinsicht wie eine Bedrohung aus. Die Logik war einfach und symmetrisch: Wenn die Ukraine sich bewaffnet, um abzuschrecken, müssen wir auch aufrüsten, so dachte man in Russland. Das Ergebnis war im Februar 2022 der größte Krieg in Europa seit 1945. Russland griff die Ukraine an, bevor die Ukraine militärisch zu stark werden konnte. Ein Witz machte schon vor 2022 die Runde: „Wenn ihr nicht mit Lawrow (dem Außenminister) sprechen wollt, dann werdet ihr mit Schoigu (dem damaligen Verteidigungsminister) sprechen!“
Eine militärische Haltung führt zu weiterer Militarisierung
Das Problem ist in den internationalen Beziehungen bekannt und wird als „Sicherheitsdilemma“ bezeichnet. Es ist ein Teufelskreis: Ein Staat rüstet sich zur Verteidigung auf, aber sein Nachbar sieht diese Schritte als aggressiv an und reagiert seinerseits mit weiterer Aufrüstung. Was als Verteidigung begann, ist nicht mehr von einer Vorbereitung auf einen Angriff zu unterscheiden.
Das Sicherheitsdilemma ist ein strukturelles Merkmal eines anarchischen internationalen Systems, in dem es keine zentrale Autorität gibt. Dies wurde bereits 1950 vom US-Politologen John Herz erkannt, der den Begriff „Sicherheitsdilemma” prägte: Versuche eines Staates, seine Sicherheit zu erhöhen, führen in der Regel zu einer erhöhten Unsicherheit in anderen Staaten. Dieser Punkt wird heute oft von dem US-amerikanischen Politikwissenschaftler John Mearsheimer angesprochen, der sich zur Schule des „Realismus” in den internationalen Beziehungen bekennt. Mearsheimer warf dem Westen bereits 2014 vor, durch die NATO-Erweiterung für die Ukraine-Krise verantwortlich zu sein. Dafür wird Mearsheimer heute ausgegrenzt und ständig beschuldigt, pro-russisch zu sein und pro-russische Propaganda zu betreiben. Doch die Realität hat ihm Recht gegeben.
Die Kritiker des „Realismus” argumentieren, dass die Ukraine weit davon entfernt war, der NATO beizutreten. Doch 2022 war die Ukraine de facto schon NATO-Mitglied, mit Waffen, militärischer und nachrichtendienstlicher Unterstützung durch NATO-Länder und gemeinsamen Manövern auf ukrainischem Boden. Die ukrainische Verfassung, die zuvor die Ukraine als neutralen Staat positionierte, wurde nach der antirussischen Maidan-Revolution geändert, sodass das Ziel einer zukünftigen NATO-Mitgliedschaft darin verankert wurde.
In Osteuropa verlief die Dynamik des Sicherheitsdilemmas wie aus dem Lehrbuch. Nach der Krim intensivierte die NATO ihre Übungen im Baltikum und in Polen. Die Ukraine erhielt Fortbildungen von US-amerikanischen und britischen Militärberatern. Westliche Waffen flossen still und leise nach Kiew. Russland wiederum begann mit groß angelegten Manövern nahe der ukrainischen Grenze und in Belarus. Die Spirale drehte sich weiter. Jede Seite behauptete, lediglich auf die andere zu reagieren. Keine Seite gab nach. Beide glaubten, die andere würde zurückweichen. Es war die letzte, fatale Schleife in der Logik der Abschreckung.
Der Mythos vom Frieden durch Stärke
Heute wird der Ausdruck „Frieden durch Stärke“ wie ein Evangelium zitiert. Reagan benutzte ihn, um das Wettrüsten gegen die UdSSR zu rechtfertigen. Bush benutzte ihn, um die Invasion des Irak 2003 zu rechtfertigen. Heute taucht er wieder auf. Aber was, wenn die Prämisse falsch ist?
Nehmen wir Georgien im Jahr 2008. Nach Jahren der Zusammenarbeit mit der NATO und westlicher Militärhilfe glaubte Georgiens nationalistischer Präsident Micheil Saakaschwili, sein kleines Land könne Russland widerstehen. Als es zu Kämpfen um Südossetien kam, reagierte Russland mit überwältigender Gewalt. Georgien verlor die Schlacht, und der Westen konnte plötzlich nicht mehr helfen. Die Vorbereitung auf den Krieg hatte keinen Frieden gebracht – sie hatte den Einsatz erhöht und Georgien dann schutzlos zurückgelassen. Georgien glaubte, stark genug zu sein – bis es das nicht mehr war.
Die gleiche Logik verfolgte die Ukraine. Von 2014 bis 2022 hatte sich Kiew zunehmend in Richtung einer NATO-Integration bewegt — nicht formal, aber bis auf den Namen. Es hoffte, dass der Aufbau einer starken Armee und die Sicherung der westlichen Unterstützung eine russische Aggression verhindern würden. In der Praxis gab es für Russland jedoch viele Gründe, zuzuschlagen, bevor die Ukraine zu stark befestigt war.
War die russische Invasion illegal? Wahrscheinlich. Aber darum geht es nicht. Der Punkt ist, dass aus russischer Sicherheitsperspektive – so verzerrt oder ungerecht sie uns in Europa auch erscheinen mag – die Militarisierung der Ukraine wie eine existenzielle Bedrohung aussah. Der Westen glaubte, damit einen Krieg zu verhindern. Russland glaubte, keine Zeit mehr zu haben. Das Ergebnis war ein umfassender Krieg.
Rüstungswahn und Trumps Verhandlungen
Im Februar 2025 machte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen eine überraschende Bemerkung: „Ich verstehe, dass viele Menschen eine friedliche Lösung oder einen Waffenstillstand für eine gute Idee halten, aber wir laufen Gefahr, dass der Frieden in der Ukraine tatsächlich gefährlicher ist als der Krieg“. Ihre anscheinend bizarre Argumentation spiegelte die tief verwurzelte Überzeugung wider, dass nur militärischer Druck echte Sicherheit bringen könne. Frieden selbst wurde nun als Risiko angesehen. Dänemark ist ein kleines Land und was die dänische Premierministerin sagt, hat nur eine relative Bedeutung. Doch was die dänische Politikerin laut sagte, wurde auch in anderen europäischen Ländern signalisiert. Nach dem ersten Telefonat zwischen Putin und Trump geriet Europa in Aufrüstungswahn. Deutschland und andere EU-Länder bekundeten eine massive Erhöhung der Militärausgaben. Ursula Von der Leyen unterstützte das mit Begeisterung. Überall auf dem Kontinent warnen heute die Staats- und Regierungschefs vor der russischen Bedrohung und wollen Milliarden in Waffen investieren.
Dass das passierte, gerade als der US-Präsident Donald Trump begann, sich für eine Verhandlungslösung im Ukraine-Konflikt einzusetzen, ist natürlich merkwürdig. Was auch immer man von Trump halten mag, es zeichnete sich eine Chance für Diplomatie ab. Doch Europa reagierte nicht mit strategischer Vorsicht, sondern mit einer Verdopplung seiner militärischen Kräfte. Wenn Putin in der Ukraine gewinnen würde, dann würde Russland woanders in Europa angreifen, so hieß es.
Doch die derzeitige Stimmung birgt die Gefahr, genau das zu provozieren, was sie verhindern will. Je mehr die NATO die baltischen Staaten stärkt, desto mehr betrachtet Russland die Region als Druckpunkt. Desto wahrscheinlicher wird ein russischer Angriff auf einen der baltischen Staaten in der Zukunft. Eine Lösung, die das Problem provoziert, das sie zu lösen versucht, kann per definitionem keine gute Lösung sein. Je mehr die EU ihre Rüstungskäufe koordiniert, desto mehr sieht Moskau die EU als de facto kriegführende Partei. Was auf dem Papier abschreckt, provoziert in der Praxis.
Die israelisch-arabische Rüstungsspirale
Der Nahe Osten bietet ein weiteres düsteres Beispiel für das Sicherheitsdilemma. Israel, umgeben von feindlichen Nachbarn, hat stets die militärische Überlegenheit als Grundpfeiler seines Überlebens betont. Seine Doktrin der „qualitativen militärischen Überlegenheit“ stellt sicher, dass es jede Allianz arabischer Staaten militärisch übertrumpfen muss.
Aber dieses Streben nach Überlegenheit hat die Region nicht friedlicher gemacht – es heizte sie an. Die arabischen Staaten reagierten darauf, indem sie sich ebenfalls bewaffneten. Auch die nuklearen Ambitionen des Iran stehen beispielsweise in direktem Zusammenhang mit den Fähigkeiten und Drohungen Israels. Das Ergebnis ist permanente Instabilität: Die eine Seite bewaffnet sich, um sich sicher zu fühlen, die andere bewaffnet sich, weil sie sich unsicher fühlt.
Im Jahr 2023 sah sich Israel dem tödlichsten Angriff seiner modernen Geschichte gegenüber, nicht von einer konventionellen Armee, sondern von einer entschlossenen Miliz – der Hamas –, die von Umzingelung und Ungerechtigkeit angetrieben wurde. Jahrzehntelange überwältigende militärische Dominanz Israels hatte keinen Frieden gebracht, sondern Verzweiflung und Radikalisierung.
Wenn sich alle bewaffnen, fühlen sich alle unsicher
Die weltweiten Militärausgaben überstiegen 2024 2,7 Billionen Dollar, mehr als ein Drittel davon durch die USA. Jede Großmacht rechtfertigt ihren Rüstungsaufbau als „defensive“ Notwendigkeit. China baut Raketen, um der Dominanz der US-Marine entgegenzuwirken. Die USA verstärken ihre Präsenz im Pazifik und auf Taiwan, um China „abzuschrecken“. Indien kauft Jets, um Pakistan zu übertrumpfen. Pakistan erweitert sein Atomwaffenarsenal, um Indien „auszugleichen“. Der Kreislauf ist endlos – und er ist nicht hypothetisch.
In jedem Fall fühlt sich jede Seite als Opfer. Jede Seite betrachtet ihre eigenen Handlungen als rational, friedlich, ja sogar edel. Aber das Endergebnis ist nicht Stabilität – es ist Angst. Die Vorbereitung auf den Krieg führt zu Spannungen, Fehleinschätzungen und allzu oft zu dem, was eigentlich verhindert werden sollte.
Es gibt Alternativen – aber sie sind langweilig
Institutionen, Verträge und Transparenz können diesen Kreislauf durchbrechen. Vertrauensbildende Maßnahmen, Rüstungskontrollabkommen und multilaterale Diplomatie machen vielleicht keine Schlagzeilen – aber sie haben oft funktioniert. Der Kalte Krieg blieb trotz aller Gefahren kalt, auch dank mühsamer Verhandlungen: dem INF-Vertrag, dem Helsinki-Abkommen, dem ABM-Vertrag. Diese Abkommen entstanden nicht aus Stärke – sie entstanden aus der Angst vor dem, was Stärke auslösen könnte.
Heute gibt es diese Verträge nicht mehr. Der INF-Vertrag brach 2019 zusammen. Der Open-Skies-Vertrag folgte. Das Vertrauen ist verschwunden und wir bereiten uns wieder auf den Krieg vor.
Die Ukraine zeigt auf tragische Weise, was passiert, wenn Diplomatie zugunsten militärischer Abschreckung aufgegeben wird. Sie versuchte, sich den Weg zum Frieden mit Waffen zu ebnen. Die alte römische Weisheit „si vis pacem, para bellum” ging von einer Welt aus, in der Macht Stabilität bringt. Aber unsere Welt ist nicht Rom. Atomwaffen, Cyberkrieg, Drohnen und Stellvertreterkriege machen moderne Kriege unvorhersehbar und unkontrollierbar.
Vielleicht braucht die Welt ein neues Motto: „si vis pacem, para pacem“ – wenn du Frieden willst, bereite dich auf Frieden vor. Es ist nicht der Ausdruck eines naiven und utopischen Pazifismus, wie die Kritiker des Pazifismus meinen. Die Wahrheit ist, dass Sicherheit gegenseitig ist. Dass Abschreckung wie Provokation wirken kann. Dass Wettrüsten nicht in Frieden endet, sondern in Tragödien. Diejenigen, die in der Weisheit des Römischen Reiches Lehren über den Frieden suchen, scheinen sehr wenig über die Geschichte der Römer zu wissen. Rom hatte ein kriegerisches Reich aufgebaut, das von Kriegsherren regiert wurde und sich praktisch während seiner gesamten Existenz im Krieg befand. Diejenigen, die nach Lehren über die friedliche Koexistenz zwischen Staaten mit unterschiedlichen nationalen Interessen suchen, sollten sich anderweitig umsehen. Die Geschichte hat uns mehrmals gezeigt, wohin die Logik der Kriegsvorbereitung führt.
PS:
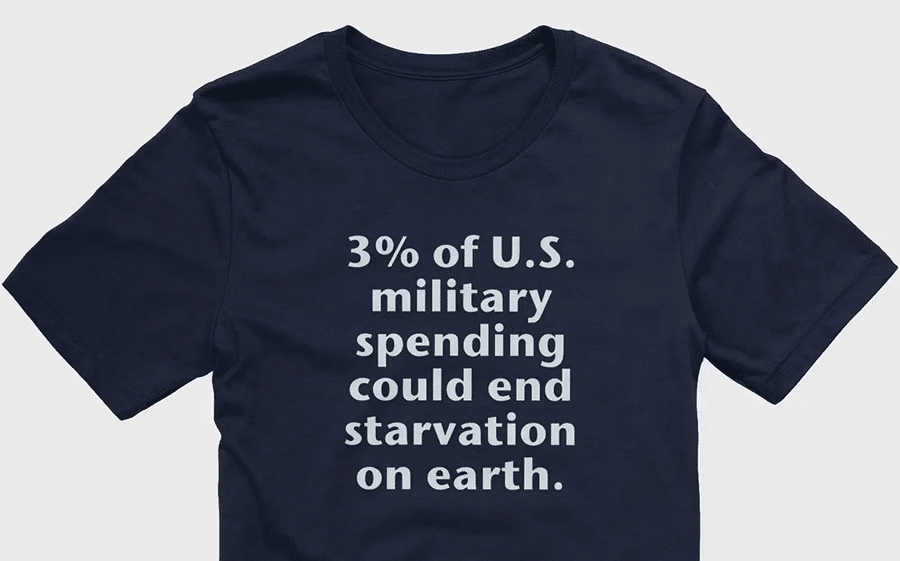
(Red.) Schon vier Jahre vor dem sogenannten Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 hat Christian Müller – im März 2018! – darauf aufmerksam gemacht, wie die NATO eng mit der ukrainischen Armee zusammenarbeitete und alles getan wurde, um die „Interoperability“ zu erreichen: hier nachzulesen.



