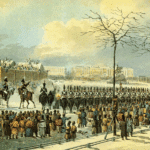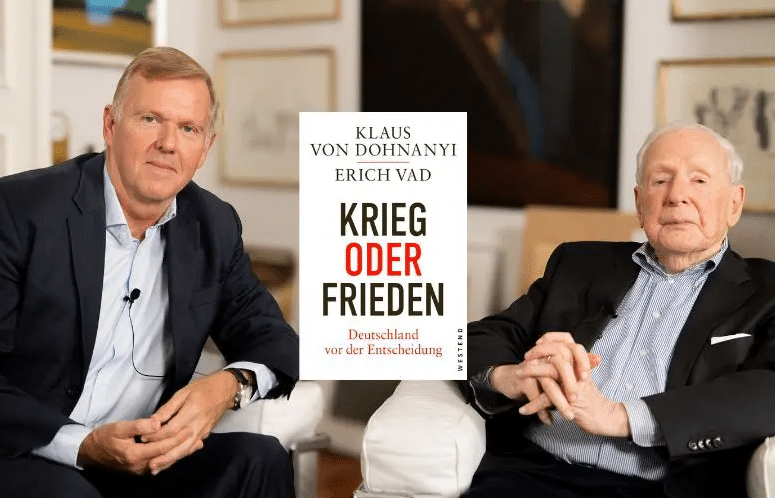
Brandgefährliche Domino-Theorien führen in den Krieg
In ihrem neuen Buch „Krieg oder Frieden“ aus dem Westend Verlag legen der frühere Bundesminister Klaus von Dohnanyi und Brigadegeneral a.D. Erich Vad, der langjährige militärpolitische Berater der damaligen Kanzlerin Angela Merkel, ihre Thesen zur aktuellen Sicherheitslage dar. Sie beleuchten die strategischen Fehler des Westens und die eigentlichen Ursachen des Ukraine-Krieges. Vad bricht mit dem vorherrschenden Narrativ und bezeichnet die deutsche Politik als „Weltmeister im Moralisieren“. Er plädiert für eine Abkehr von rein militärischen Lösungen und für eine Außenpolitik, die sich auch an deutschen Interessen orientiert. Diese sollte neben militärischer Abschreckung auch auf Diplomatie und Frieden setzen. – Éva Péli hat mit Erich Vad gesprochen.
Éva Péli: Herr Vad, Bundeskanzler Friedrich Merz warnt in Bezug auf den Krieg in der Ukraine davor, dass nach der Ukraine auch Deutschland an der Reihe sein könnte. Wie realistisch ist diese Einschätzung aus Ihrer Sicht?
Erich Vad: Ich lehne das oft bemühte Narrativ der Domino-Theorie ab, wonach Deutschland nach der Ukraine bedroht wäre. Aus russischer Sicht geht es in diesem Krieg darum, eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu verhindern. Für mich ist genau das der „casus belli“– die eigentliche Ursache und der Auslöser des Krieges.
2008 war ich mit der damaligen Bundeskanzlerin beim NATO-Gipfel in Bukarest. Sie hat dort zu Recht die Aufnahme der Ukraine in die NATO verhindert. Nicht nur die Russen, sondern auch der damalige US-Botschafter in Moskau, William J. Burns, gaben damals klare Signale, dass dies eine „dunkelrote Linie“ für Russland sei. Unsere Informationen zeigten zudem, dass die Ukrainer selbst gar nicht bereit für einen NATO-Beitritt waren. Die Ukraine erfüllte – und erfüllt bis heute – in keiner Weise die Beitrittskriterien.
Die politischen und militärischen Vorbereitungen des Westens, angeführt von den USA, für einen NATO-Beitritt der Ukraine waren die tatsächliche Ursache dieses Krieges. Dieser Umstand wurde übrigens auch vom jetzigen US-Präsidenten nach seiner Amtsübernahme bestätigt.
Zudem fehlen Russland die militärischen Kapazitäten, um die NATO anzugreifen. Sie versuchen seit fast dreieinhalb Jahren, den Donbass zu besetzen, und sind immer noch nicht am Ziel. Ihre derzeitigen Streitkräfte reichen bei Weitem nicht aus, um die gesamte Ukraine einzunehmen, geschweige denn, die NATO anzugreifen. Dies ist militärisch einfach nicht möglich. Selbst wenn es den politischen Willen gäbe, wären die Kräfte nicht vorhanden. Die Allianz in Europa verfügt selbst ohne die USA über eine klare konventionelle Überlegenheit gegenüber Russland. Schaut man sich beispielsweise die Frontabschnitte an der ostpolnischen Grenze an, haben die polnischen Streitkräfte – ohne jegliche NATO-Verstärkung – eine dreieinhalbfache militärische Überlegenheit.
Das Baltikum ist militärisch natürlich sehr exponiert und schwierig zu verteidigen. Ja, das stimmt: Dort könnte Russland militärisch aktiv werden, wenn es das wollte. Man darf jedoch nicht vergessen, dass für einen künftigen Friedensschluss mit der Ukraine die extrem lange Demarkationslinie gesichert und überwacht werden muss – und das auch von russischer Seite. Russland kann nicht einfach alle seine Kräfte von dort abziehen, um an einer anderen Front die NATO anzugreifen. Das ist militärisch nicht umsetzbar. Was in ein paar Jahren sein wird, ist reine Spekulation.
Zudem gibt es keinerlei politische Absichtserklärungen des Kremls. Nennen Sie mir ein einziges Dokument, das belegt, dass Putin die Absicht hat, die NATO anzugreifen. Diese Annahme ist reine Spekulation. Selbst eine zusammenfassende Bewertung der US-amerikanischen Nachrichtendienste kommt zu dem Schluss, dass es weder die politische Absicht noch das militärische Potenzial für einen russischen Angriff auf die NATO gibt.
Man muss sich vor solchen Domino-Theorien in Acht nehmen, denn sie sind brandgefährlich. Ein Beispiel dafür ist der Vietnamkrieg: Er dauerte zehn Jahre und hinterließ zweieinhalb Millionen Tote sowie ein verwüstetes Land, nur weil die US-Amerikaner der fixen Idee anhingen, ganz Südostasien würde kommunistisch, wenn erst Vietnam kommunistisch wäre. Diese gefährliche Theorie führte zu einem fürchterlich langen Krieg.
Éva Péli: Nun steht die Debatte um eine Reform der Wehrpflicht im Raum. Wie bewerten Sie als Militärexperte und langjähriger Berater von Alt-Kanzlerin Angela Merkel die aktuellen Pläne, Deutschland „kriegstüchtig“ zu machen?
Erich Vad: Die Bundeswehr war zu Beginn des Ukraine-Krieges „blank“. Das hat damals der Inspekteur des Heeres öffentlich gesagt, und sie ist heute noch blanker als blank, weil Deutschland auch Waffen aus den Beständen der Bundeswehr an die Ukraine geliefert hat und weiterhin liefert. Ich finde es richtig, dass jetzt etwas getan wird, um die deutschen Streitkräfte für die Landesverteidigung wieder funktionsfähig zu machen. Dazu gehört natürlich auch die Diskussion um die Wehrpflicht. Beim letzten NATO-Gipfel wurde ein personeller Aufwuchs für alle NATO-Staaten beschlossen, und Deutschland muss von seinen 180.000 Soldaten in den nächsten Jahren schrittweise auf 260.000 Soldaten aufwachsen. Ohne Wehrpflicht ist das schwer machbar. Die Bundeswehr versucht, gemäß dem schwedischen Modell auf Freiwilligkeit zu setzen. Wichtig ist aber auch, dass es attraktiv ist, in Deutschland zur Armee zu gehen. Die Wehrbereitschaft ist nicht sehr ausgeprägt in Deutschland.
Umso erstaunlicher ist die Kriegs-Rhetorik mancher deutscher Politiker, die nie in einer Kaserne waren, nie eine Waffe in der Hand hielten und nie einen Stahlhelm aufhatten. Das hat mich ein bisschen amüsiert. Das waren oft dieselben, die in den letzten Jahren alles getan haben, um die Bundeswehr klein zu halten. Es ist auch eine politische Aufgabe klarzustellen, dass die Bundeswehr – wie in unserer Verfassung vorgegeben – zur Verteidigung eingesetzt wird und Deutschland nicht am Hindukusch, in Mali, am Dnipro oder im Indo-Pazifik verteidigt wird. Die Geschäftsgrundlage der deutschen NATO-Mitgliedschaft ist die Verteidigung: Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis und darf nicht zu einem Transmissionsriemen weltweiter Militäreinsätze – wie unter den Vorgängerregierungen von Donald Trump – verkommen. Dazu gehörte auch eine sehr offensive Erweiterungspolitik, vor allem mit Blick auf die Ukraine und Georgien. Das war ein strategischer Fehler des Westens, den die jetzige Regierung der USA korrigieren will.
Éva Péli: Sie unterscheiden im Gespräch mit Klaus von Dohnanyi zwischen Verteidigung und Sicherheit. Worin liegt der grundlegende Unterschied, und wer bedroht Deutschland und die EU?
Erich Vad: Auf diesen Unterschied hat Klaus von Dohnanyi im Gespräch zu Recht hingewiesen. Er mahnte an, dass Sicherheit mehr als nur Verteidigung ist. Zur Sicherheit gehören zwar einsatzfähige Streitkräfte, aber eben nicht nur. Genauso wichtig sind Dialog, Interessenausgleich, Verständigung und vertrauensbildende Maßnahmen mit potenziellen Gegnern. All dies waren grundlegende Elemente der Politik im Kalten Krieg.
Die NATO hat damals niemals allein auf militärische Verteidigungsbereitschaft gesetzt, sondern immer auch auf Dialog und Interessenausgleich mit Russland. Die deutsche Politik war besonders darauf bedacht, diesen Ansatz zu verfolgen, da Deutschland im Kalten Krieg das potenzielle Schlachtfeld gewesen wäre. Wir waren geteilt und hatten die höchste Konzentration an Streitkräften weltweit auf unserem Territorium.
Heute hat sich vieles verändert, doch eines ist gleich geblieben: Deutschland wäre in einem potenziellen europäischen Krieg erneut das Hauptschlachtfeld. Wir sind die logistische Drehscheibe der NATO, ihr Aufmarschgebiet, und die US-Hauptquartiere befinden sich in unserem Land, bald auch wieder amerikanische Mittelstreckenraketen. Viele Politiker scheinen nicht zu verstehen, dass Deutschlands geografische Lage uns direkt in das Zentrum rückt, falls der Ukraine-Krieg zu einem europäischen Krieg eskaliert.
Wir brauchen ein politisches Konzept, wie wir aus diesem sinnlosen Krieg herauskommen. Dafür müssen wir mit den Russen reden und verhandeln. Es gibt seit Jahren keine militärische Lösung in diesem Krieg, die aus Sicht der Ukraine zufriedenstellend ist. Dieser Krieg ist deswegen sinnlos, und das Fortführen von Waffenlieferungen auch.
Donald Trump bin ich dankbar dafür, dass er nach seiner Amtsübernahme diese Initiative ergriffen hat. Ich bin hingegen enttäuscht von den Europäern, weil ihnen seit fast dreieinhalb Jahren nichts weiter einfällt, als nur Waffen zu liefern. Das ist zu wenig. Viktor Orbán war einer der wenigen europäischen Politiker, der die Ratspräsidentschaft von Ungarn 2024 für eine Friedensinitiative genutzt hat und er wurde dafür von Brüssel gerügt.
Éva Péli: Sie betonen, dass Kriege eine politische Vorgeschichte haben. Was sind Ihrer Meinung nach die entscheidenden politischen Versäumnisse oder Fehlentscheidungen der vergangenen Jahre, insbesondere aufseiten des Westens, die den Boden für den Ukraine-Krieg bereitet haben?
Erich Vad: Für die russische Seite war die faktische NATO-Osterweiterung natürlich immer ein sehr kritischer Punkt und letztlich aus russischer Sicht nicht akzeptabel. Zu Beginn der Osterweiterung wurde diese objektive Verschlechterung der strategischen Lage Russlands durch eine Reihe politischer und diplomatischer Initiativen aufgefangen: Russland wurde in die G8 und in die Welthandelsorganisation aufgenommen, es gab die NATO-Russland-Grundakte, und die Russen unterhielten sogar eine Militärmission bei der Allianz. Das Klima war sehr entspannt, und vor diesem Hintergrund konnte Russland die NATO-Osterweiterung anfangs akzeptieren.
Allerdings wurde dieses Vertrauen über die Maßen strapaziert, insbesondere mit Blick auf die Ukraine und Georgien. Spätestens auf dem NATO-Gipfel in Bukarest 2008 war klar, dass dies für Putin ein Kriegsgrund sein würde. Die damalige Kanzlerin hat dies, wie bereits erwähnt, erkannt und wusste, dass es faktisch einen Krieg mit Russland provozieren würde. Im August desselben Jahres hatten wir dann auch den Krieg in Georgien. Wäre der NATO-Beitritt der Ukraine damals nicht verhindert worden, hätte es diesen Krieg meines Erachtens bereits 2008 gegeben.
Ich habe meinen US-amerikanischen Freunden die Situation so erklärt: Stellen Sie sich vor, in Mexiko käme durch russische und chinesische Unterstützung eine russland- und chinafreundliche Regierung an die Macht. Diese würde dann über Militärstützpunkte am Rio Grande verhandeln, Militärmanöver mit Russen und Chinesen in Mexiko veranstalten und Seemanöver im Golf von Mexiko abhalten. All das hat der Westen in der Ukraine und im Schwarzen Meer vor der Krim getan. Was würden die Amerikaner tun? Die Antwort meiner Freunde war sofort klar: Wir würden sofort einmarschieren.
Ein anderes Beispiel ist die Kubakrise. John F. Kennedy konnte 1962 aus strategischen Gründen nicht zulassen, dass die Sowjets auf Kuba militärisch Fuß fassten. Für die USA war das nicht verhandelbar, und sie hätten in einen Krieg mit Russland ziehen müssen, so gefährlich es damals auch war, weil sie keine andere Wahl hatten. Man muss solche strategischen Rahmenbedingungen in der Diskussion einfach mitberücksichtigen.
Natürlich war der russische Überfall auf die Ukraine völkerrechtswidrig. Aber ich bitte Sie, es gibt jede Menge Kriege, die völkerrechtswidrig waren. Das Völkerrecht ist wichtig, ich möchte das nicht relativieren, aber man muss eben auch diese strategischen Fakten und Zahlen sehen. Aus ähnlichen Gründen würde China zum Beispiel niemals zulassen, dass Taiwan unter US-Kontrolle gerät und dort Militärbasen errichtet werden. Das sind Dinge, die man auch mit Blick auf die russischen Sicherheitsinteressen berücksichtigen muss, denn Russland ist eine Großmacht und die stärkste Nuklearmacht der Welt.
Éva Péli: Eine Nebenbemerkung: Zur Kubakrise gehört auch, dass die USA vorher Atomraketen unter anderem in der Türkei stationiert hatten und der „Deal“ dann war, dass die Sowjetunion ihre Raketen zurückzieht und die USA ihre Raketen aus der Türkei abziehen.
Erich Vad: Ja, klar, diesen „Deal“ hat man hinterher gemacht, und er wurde nicht an die große Glocke gehängt. Man hat so getan, als wären die US-Amerikaner die alleinigen Sieger. Aber Insider wussten natürlich, dass es am Ende um einen Deal – ich spreche altmodisch von Kompromiss – ging. Wir brauchen jetzt im Ukrainekrieg auch einen Kompromiss. Denn viele Kriege wurden durch Kompromisse beendet.
Ich verstehe nicht, warum man so über Donald Trump herzieht. Aus meiner Sicht ist es gut, dass er versucht, einen Kompromiss oder wie er sagen würde, einen „Deal“ mit den Russen auszuhandeln, damit wir aus diesem Krieg herauskommen. Das Gefährliche ist nur, dass die Europäer im Moment da nicht konstruktiv mitmachen. Sie zeigen eine große Solidarität mit der Ukraine, was lobenswert ist. Aber die momentane Politik der Europäer ist komplett gegen die eigenen europäischen Interessen gerichtet. Deshalb kann man nur hoffen, dass es funktioniert. Denn wenn es nicht funktioniert, rutschen wir in einen Krieg, und das kann keine Option sein.
Allerdings für die Amerikaner schon. Die USA haben zwei geostrategische Optionen: Sie könnten einen Krieg in Europa führen. Dieser wäre 6000 Kilometer von den USA entfernt und er kann für sie unter gewissen Bedingungen politisch, wirtschaftlich und militärisch ein „Big Business“ sein. Aber Trump möchte das nicht. Er möchte den zweiten Weg gehen. Wir Europäer sind wirklich aufgerufen, das Zeitfenster zu nutzen, das wir im Moment haben. Man weiß ja nicht, ob Donald Trump im November 2028 wiedergewählt wird. Wir haben jetzt drei Jahre Zeit, um aus diesem Krieg herauszukommen.
Éva Péli: Herr Vad, in Ihrem Buch „Krieg oder Frieden“ zitieren Sie den US-General Smedley D. Butler, der sagte, Krieg sei ein Geschäft. Wer sind Ihrer Meinung nach in Europa und insbesondere in Deutschland die Akteure oder Interessengruppen, die eine kriegerische Haltung fördern? Wie nutzen sie diese Haltung, um von wirtschaftlicher Stagnation abzulenken, und wie manifestiert sich dieser Einfluss in der Politik?
Erich Vad: Krieg war und ist immer auch ein Geschäft, vor allem für die Rüstungsindustrie, aber auch für die Wirtschafts- und Finanzwelt insgesamt. Das liegt in der Natur des Krieges, auch wenn er für edle Motive geführt wird. Doch die deutsche Wirtschaft stagniert offensichtlich bereits im vierten Jahr. Die ersten Automobilwerke werden in Rüstungsunternehmen umgewandelt. Auch in der Start-up-Branche gibt es in Deutschland und ganz Europa eine starke Bewegung in Richtung auf den Rüstungssektors. Man glaubt, dadurch die Wirtschaft wiederbeleben zu können.
Aber das ist sehr kurzsichtig gedacht, vor allem, wenn die Waffen und die Munition, die wir jetzt herstellen, im eigenen Land eingesetzt werden. Das ist im Grunde kein „Big Business“. Die US-Amerikaner haben ihre Kriege immer weltweit geführt und viele Waffen exportiert. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir uns nicht auch aus vordergründigen ökonomischen Gründen immer tiefer in diesen Krieg in der Ukraine verstricken und eines schönen Tages in einem europäischen Krieg aufwachen.
Auch Putin ist in seiner Kriegswirtschaft gefangen. Für ihn wird es schwierig, wieder herauszukommen, da er sonst Hunderttausende Soldaten demobilisieren müsste. Das könnte auch für ihn ein Grund sein, nicht allzu sehr an Frieden interessiert zu sein.
Diese Entwicklung ist zudem sehr gefährlich, sie steuert auf einen europäischen Krieg zu und viele Politiker in Europa reden ihn regelrecht herbei. Manche sagen sogar, wir seien bereits im Krieg, aufgrund der hybriden Zwischenfälle, die es auf beiden Seiten gibt. Wir müssen sehr, sehr aufpassen. Wenn wir nicht achtsam sind, finden wir uns plötzlich im Krieg wieder. Das kann keine Option für Europa sein, vor allem nicht für Deutschland. Angela Merkel hat das immer gesagt: Man muss vom Ende her denken.
Éva Péli: Sie fordern in Ihrem Buch „Ernstfall für Deutschland“ mit Blick auf das Verhältnis zu den USA: „Abnabeln, emanzipieren, selbst denken.“ Wie ließe sich das in der Praxis in der Außen- und Sicherheitspolitik umsetzen?
Erich Vad: Das ist eine schwierige Frage. Wir Deutsche müssen wieder lernen, in Kategorien von strategischen und politischen Interessen zu denken, ganz ohne Nationalismus. Wir müssen mehr darauf achten, was aus unserem Land wird und in welche Richtung es sich entwickelt. Früher waren wir Weltmeister in der Kriegsführung, heute sind wir Weltmeister im Moralisieren. Moralisierung führt jedoch in eine Sackgasse, denn man verstrickt sich schnell in eine offensichtliche Doppelmoral.
Es geht nicht nur um Russland, sondern auch um die Migrationsfrage in Europa. Wir starren alle auf Russland, aber Europas gesamte Südgrenze ist offen, und wir werden regelrecht von illegaler Migration überschwemmt. Wir wissen gar nicht, wie Europa und Deutschland in zehn Jahren aussehen werden, wenn das so weitergeht. Wir müssen wirklich stärker darauf schauen, was aus uns wird, und nicht so viel Altruismus für arme Menschen in der Welt empfinden, die alle nur eines wollen: zu uns kommen. Das funktioniert nicht, wir müssen das steuern. Viele Politiker haben hier versagt, indem sie ein steuerndes Einwanderungsgesetz zu lange verhindert haben und manche es auch heute noch tun.
In der Außen- und Sicherheitspolitik verhält es sich genauso. Wir müssen einfach stärker an uns denken: Wenn der Ukraine-Krieg zu einem europäischen Krieg eskaliert, könnten wir alles verlieren, was wir haben und uns aufgebaut haben. Ich will keine Angst schüren; wir brauchen eine starke Armee, so stark, dass niemand es wagt, uns anzugreifen. Das ist alles in Ordnung. Aber ich brauche dafür kein Feindbild Russland.
Das ist Staatspolitik. Ich denke, daran mangelt es in Deutschland, und ich hoffe, dass wir das wieder in den Griff bekommen. Manchmal bin ich jedoch skeptisch, ob uns das gelingt.
Éva Péli: Könnte Deutschland nicht auch „Friedensweltmeister“ werden, indem es sich aufgrund seiner historischen Erfahrungen mit all seinen Möglichkeiten, auch den wirtschaftlichen, für den Frieden einsetzt?
Erich Vad: Das war in der Vergangenheit stets die deutsche Politik. Unser Grundgesetz enthält ein starkes Friedensgebot, das uns vorschreibt, nicht weltweit mit Streitkräften aktiv zu sein und Frieden durch Waffen und Kriege zu schaffen. Zu diesem Grundsatz müssen wir zurückkehren.
Dennoch brauchen wir ein funktionsfähiges Militär. Ich bin nicht dafür, abzurüsten und dann mit Friedenstauben durch die Gegend zu laufen – das würde uns nichts nützen. Schließlich sind wir Mitglied eines Militärbündnisses, und ein Alleingang wäre nicht klug.
Wie gesagt, Deutschland ist ein nicht unwichtiger Mitgliedsstaat der NATO. Wir müssen darauf achten, dass das transatlantische Militärbündnis nicht zum reinen verlängerten Arm für US-Militärinterventionen wird. Stattdessen muss der ursprüngliche Charakter als reines Verteidigungsbündnis erhalten bleiben. Gerade hier liegt eine wichtige Aufgabe für Deutschland. Und das wäre dann auch ein essenzieller Beitrag zum internationalen Frieden. Es ist ein schwieriger, aber aus deutscher Sicht wichtiger Weg.
Éva Péli: Sie sprechen mit Klaus von Dohnanyi darüber, dass der Maidan 2013/14 von außen, nämlich von den USA, gelenkt, gesteuert und beeinflusst wurde. Im kommenden Jahr stehen auch in Ungarn Wahlen an. Sehen Sie hier Parallelen zu den von Ihnen beschriebenen Mechanismen der Einflussnahme, um eine bestimmte Regierung zu installieren?
Erich Vad: Ich bin davon überzeugt, dass es solche Mechanismen in den internationalen Beziehungen gibt, auch in Bezug auf Ungarn. Diese Aktionen können gewaltlos sein oder mit Gewalt einhergehen. Die USA, angetrieben von ihrem Selbstverständnis als Weltordnungsmacht, praktizieren dies seit Jahrzehnten. Sie haben vor allem in Lateinamerika, aber auch anderswo, stets darauf geachtet, befreundete Regierungen zu installieren und feindlich gesonnene abzusetzen.
In meinem Buch habe ich die Arbeit von Lindsay A. O’Rourke zitiert, die die US-amerikanischen Regime-Change-Operationen während des Kalten Krieges von 1945 bis 1990 analysierte. Sie dokumentierte 66 solcher Operationen, deren Ziel es war, gewünschte Regierungen einzusetzen und feindliche zu stürzen. Dabei wurde nicht nur auf militärische Gewalt gesetzt, sondern auch auf Geheimdienstoperationen, bei denen erhebliche Geldmittel in die jeweilige Opposition flossen. Das ist eine gängige Praxis.
Dieser Ansatz ist auch heute relevant, wenn wir Russland vorwerfen, im Frühjahr 2022 eine „Regime-Change-Operation“ in Kiew versucht zu haben. Die Russen wollten damals keinen langen Krieg, sondern einen schnellen Handstreich, um eine russlandfreundliche Regierung zu installieren. Diese Operation scheiterte jedoch aus militärischen Gründen. Die Russen sind einfach keine Meister darin – die USA aber schon.
Ich selbst wurde bei den US-Streitkräften ausgebildet und weiß: ‚Regime-Change-Operationen‘ gehören zum Repertoire einer Großmacht, die sich als Weltordnungsmacht versteht. Ähnliche Muster scheinen sich derzeit in Venezuela abzuzeichnen, wo es nicht nur um einen illegitimen Präsidenten oder Drogenkartelle geht, sondern auch um handfeste Wirtschaftsinteressen. Unzählige Beispiele für größere Militärinterventionen der USA – abseits der vielen verdeckten Operationen – finden sich in der Karibik, in Panama, Grenada, im Irak, in Syrien, Afghanistan und Libyen.
Russland versuchte in der Ukraine genau das, was die USA perfektionieren: keinen großen Krieg, sondern einen schnellen, entscheidenden Schlag. Das scheiterte, genau wie der US-Versuch, die Ukraine in die NATO zu holen. Jetzt bleibt abzuwarten, wie man politisch aus dieser Lage wieder herausfindet.
Éva Péli: Der Titel Ihres gemeinsamen Buches mit Klaus von Dohnanyi lautet „Krieg oder Frieden“. Was halten Sie für das wahrscheinlichste Szenario in den kommenden Jahren, und was können einfache Bürger tun, um einer weiteren Eskalation entgegenzuwirken und zur Deeskalation beizutragen?
Erich Vad: Ich habe für mein Buch „Ernstfall für Deutschland“ sehr viel Zuspruch von den sogenannten „einfachen Menschen“ erhalten, die mir auf der Straße, im Zug oder am Flughafen begegnen. Mein Buch sollte veranschaulichen, was im Falle eines Krieges in Europa mit unserem Land passieren würde. Dieser Rückhalt bestärkt mich sehr, gerade weil meine Position, die nicht dem Mainstream entspricht, oft angegriffen wird.
Die Umfragen geben mir recht: Sie sind ziemlich eindeutig. Eine Mehrheit der Deutschen möchte keinen Krieg mit Russland, und die Mehrheit der Ukrainer will aus diesem Krieg heraus. Ich frage mich, ob Wolodymyr Selenskyj tatsächlich die Meinung der Ukrainer repräsentiert. Es gibt auch andere Politiker, wie zum Beispiel Vitali Klitschko, die anders mit diesem Thema umgehen möchten. Die Menschen wollen keinen Krieg, aber ich glaube, dass sie im Ernstfall nicht gefragt werden.
Die Machtverhältnisse sind klar: Wenn Donald Trump „Let’s go to war“ sagen würde, würden wir alle in einen Krieg ziehen, ob wir wollen oder nicht. Glücklicherweise sagt er, dass er Frieden will. Es sind nun die Europäer, die stur den alten, ausgetretenen und erfolglosen Weg der Waffenlieferungen und der Eskalation weitergehen wollen und sich weigern, eine politische Lösung zu finden. Das treibt uns regelrecht in einen Krieg. Ich halte diesen für unvernünftig und hoffe, dass wir ihn verhindern können. Es ist jedoch nicht sicher, ob der Frieden bewahrt werden kann. Die Gegenkräfte sind sehr stark, auch in den USA.
Éva Péli: Herr Vad, herzlichen Dank für das Gespräch.
Zum Buch: Klaus von Dohnanyi / Erich Vad: Krieg oder Frieden. Deutschland vor der Entscheidung.
Westend Verlag, 144 S., 20 €