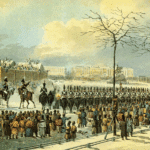Der erfundene Feind – Der Westen hat seine Souveränität verloren – an die Angst
Das Feindbild Russland ist in den vergangenen Jahren zur großen Schablone europäischer Sicherheitspolitik geworden. Es dient als Folie, auf die nahezu jedes sicherheitspolitische Dossier projiziert werden kann: Abschreckung, Sondervermögen, Truppenübungen, Sanktionen, neue Rüstungsprogramme, die Einführung oder Reaktivierung wehrpflichtiger Strukturen und die Normalisierung militärischer Präsenz in zuvor zivilen Bereichen des Alltags. Der Kern dieser Schablone ist ein Versprechen und eine Behauptung: Das Versprechen lautet, mit Aufrüstung Sicherheit herzustellen. Die Behauptung lautet, Russland plane den Angriff auf Europa. Ohne diese zweite Behauptung fiele die politische Rechtfertigung der ersten in sich zusammen.
Für jene, die Sabiene Jahn lieber hören als lesen, hier anklicken.
Dass dieser Zusammenhang kein Zufall ist, sondern einer langen historischen Kontinuität und einer gegenwärtigen politischen Logik folgt, lässt sich zeigen, wenn man Feindbilder als Instrumente versteht. Sie gehen Kriegen voraus, begleiten sie und halten sie im Bewusstsein stabil. „Feindbilder legitimieren Aufrüstung, Konfrontation und letztlich Krieg“, sagt der österreichische Historiker und Ökonom Hannes Hofbauer in einem Gespräch mit Journalist Peter Wahl. Genau dieser Legitimationsmechanismus prägt den europäischen Diskurs seit Jahren.
Wer Feindbilder analysiert, muss zunächst unterscheiden, wovon die Rede ist. Persönliche Wut und Trauer, wie sie Opfer realer Gewalt empfinden, sind nicht mit einem politisch konstruierten Feindbild zu verwechseln. Das Feindbild im engeren Sinn ist ein gesellschaftlich eingeübtes Muster, ein Set aus Zuschreibungen, das sich in Sprache, Bildern, Ritualen und politischen Routinen niederschlägt. Es ist kein spontanes Gefühl, sondern eine immer wieder abrufbare Denkfigur. Diese Figur besitzt einen historischen Resonanzraum. Die ersten westlichen Klischees über „die Russen“ lassen sich bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen, als an der Jagiellonen-Universität Krakau (Polen) ein Bild des Russen als „barbarisch, schmutzig, ungläubig“ geprägt wurde. Solche Schablonenbilder verbanden religiöse Abwertung mit kultureller Herabsetzung und wurden seither in Krisenzeiten jeweils neu aktiviert. Die Feindschaft war nicht konstant, sie flachte ab und kehrte wieder, wenn geopolitische Konflikte und wirtschaftliche Spannungen dies opportun erscheinen ließen. Genau diese Reaktivierbarkeit macht das Feindbild zu einem politischen Werkzeug.
Historisch wurde die Dämonisierung mit großer Bildmacht betrieben. Der russische „Krake“, der im Jahr 1914 seine Arme über den Kontinent legt oder die Totenschädel-Ikonographie der Zwischenkriegszeit, das „asiatische“ Gesicht des Gegners auf Plakaten des Kalten Krieges, der Kölner Dom, vor dem ein Rotarmist steht, flankiert von der Frage „Wollt ihr ihn hier haben?“ – all das sind Verdichtungen eines Narrativs, das den Gegner nicht nur politisch delegitimiert, sondern entmenschlicht. Die rhetorische Technik dahinter ist seit Jahrhunderten dieselbe: Zunächst wird der Gegner als qualitativ anders konstruiert, dann als moralisch minderwertig markiert, schließlich als existentielle Gefahr gedeutet. In dieser Logik entscheidet nicht mehr die Abwägung politischer Interessen, sondern die moralische Pflicht zur Abwehr „des Bösen“. Wenn in Heinrich von Kleists Gedicht „An die Kinder Germanias“ das Töten zur „Lustjagd“ stilisiert wird, ist die Schwelle zwischen politischer Feindschaft und enthemmter Gewaltsprachlichkeit überschritten. Das Problem ist nicht, dass es solche Texte gab, sondern dass ihre semantischen Muster – wenn auch modernisiert – bis in die Gegenwart fortleben.
Die moderne Variante dieser Bildsprache operiert mit moralischen Marken und psychologisch anschlussfähigen Symbolen. In den Jahren vor 2022 wurden in europäischen Medien und politischen Statements Vergleiche mit Hitler und Stalin wiederkehrend bemüht. Putin wurde zum totalitären Zwillingsbild des 20. Jahrhunderts stilisiert, wodurch die Gegenwart zur Wiederholung des Vergangenen umgedeutet wurde: Wer auf diese Weise argumentiert, ruft nicht zu politischer Analyse auf, sondern zur moralischen Mobilmachung. Die Vorteile dieses Modus liegen für Regierungen und sicherheitspolitische Apparate auf der Hand. Solche Erzählungen bieten eine kommunikative Abkürzung. Sie ersparen die mühsame Erklärung komplexer Konfliktgeschichten und liefern stattdessen ein universales Deutungsetikett, das sofort Handlungskredite freisetzt – wer gegen Hitler kämpft, braucht kein langes Mandat, wer das Übel in Person bekämpft, kann nicht zu viele Mittel aufwenden. „Der moralische Imperativ ist die stärkste Waffe des Westens – er ersetzt heute die religiöse Missionierung durch eine säkulare Mission“, heißt es sinngemäß im Gespräch. Damit verlagert sich Politik vom Terrain der Interessen in das Gelände der Tugend. Dort, wo Tugend regiert, wird Widerspruch verdächtig.
Das Selbstbild des Westens ist in dieser Dramaturgie die notwendige Kehrseite des Feindbildes. Dem „Bösen“ im Osten steht das „Gute“ im eigenen Lager gegenüber: Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte. Diese Werte bedürfen keines Nachweises. Sie gelten als Besitzstand. Sie werden weniger gelebt als behauptet, und gerade in der Behauptung liegt ihre Wirkung. Wer seine Moral als Prämisse voraussetzt, kann die Moralität seiner Instrumente unterstellen. Der diplomatische Boykott der Olympischen Spiele 2014 in Sotschi, begründet mit einem russischen Gesetz zur Einschränkung von „Propaganda“ für Homosexualität, war für Hofbauer ein frühes Signal dafür, dass Europa seine Konflikte mit Russland nicht nur geopolitisch, sondern moralisch führt. Seitdem hat sich der moralische Rigorismus verfestigt. Er übersetzt politische Differenzen in Kategorien des Anstands und richtet die Aufmerksamkeit weg von Verfahrensfragen hin zu Gesinnungsfragen. Der Effekt ist doppelt, er immunisiert gegen Selbstkritik und erleichtert die Ausgrenzung abweichender Stimmen im Innern.
Zu dieser inneren Disziplinierung gehört die selektive Empörung. Völkerrechtswidrige Kriege der USA und NATO – Jugoslawien, Irak, Libyen – haben massives Leid verursacht, aber keine moralische Totalmobilisierung in Europa bewirkt. Als russische Truppen 2022 in die Ukraine einmarschierten, war die juristische Bewertung als völkerrechtswidrig naheliegend. Doch die Art der Empörung, ihr Totalitätsanspruch, die Bereitschaft zur ökonomischen Selbstschädigung und die Geschwindigkeit, mit der ein umfassender Boykott kultureller und wissenschaftlicher Verbindungen eingeleitet wurde, sind ein Indiz dafür, dass mehr im Spiel war als die Verurteilung einer Rechtsverletzung. Das Feindbild war bereits da, die Deutungsmuster lagen bereit, die Schablone passte. „Wir leben in einer asymmetrischen Situation zwischen Geheimdienstnarrativen, Desinformation und moralischer Selbstblendung“, fasst Peter Wahl die Lage zusammen. In einer solchen Asymmetrie wird die Frage nach der Quelle zur Nebensache – was zählt, ist der anschlussfähige Vorwurf.
Ein entscheidender Punkt in Hofbauers Argumentation betrifft die Informationsökonomie moderner Konflikte. Politik und Öffentlichkeit sind auf Quellen angewiesen, die sie nicht prüfen können. Geheimdienste veröffentlichen selektiv und die Kenntnisstände sind ungleich verteilt. Konterinformationen werden selber als Teil gegnerischer Soft-Power abgetan. Ereignisse wie Drohnenabstürze auf polnischem Territorium oder mutmaßliche Sabotageakte sind für Bürger nicht verifizierbar. Sie werden in vorgefertigte Rahmen eingepasst. Was nicht passt, wird einzelfallbezogen erklärt oder ignoriert. Diese Praxis reduziert komplexe Lagen auf einfache moralische Urteile. Der Journalismus verliert dabei seine kritische Funktion und wird zum Verstärker sicherheitspolitischer Öffentlichkeitsarbeit, während die institutionelle Wissenschaft sich häufig aus der Normkritik zurückzieht und stattdessen die Narrative der „regelbasierten Ordnung“ wiederholt. Der Diskursraum verengt sich, wie auch die Behandlung missliebiger Stimmen zeigt. „Wer heute über Diplomatie spricht, gilt als Verräter“, sagt Hofbauer. Das ist nicht überzeichnet, es trifft einen Realitätssplitter. Aus dem Streit um Mittel ist ein Streit um Legitimität geworden.
In diesem Zusammenhang lohnt der Blick auf empirische Gegenstimmen. Der emeritierte Harvard-Professor Vladislav Brovkin hat in einer Serie von Vorträgen und Quellenanalysen gezeigt, dass selbst westliche Geheimdienstberichte Russland keineswegs als „Papiertiger“ beschreiben, sondern als widerstandsfähige, technologisch hochgerüstete und anpassungsfähige Militärmacht. Seine Analyse des „Annual Threat Assessment“ der US-Geheimdienstgemeinschaft aus März 2025 bestätigt, dass Russland in allen relevanten Bereichen – Hyperschalltechnologien, Drohnen, Artillerieproduktion, Luftabwehrsysteme – gegenüber der NATO eine erhebliche Eigenkapazität aufgebaut hat. Nach russischen wie amerikanischen Angaben liegt die Zahl der aktiven Truppen bei rund zwei Millionen Soldaten, mit etwa 700.000 in der Ukraine eingesetzten Kräften. Der Westen produziert laut Brovkin zwar mehr Rhetorik, aber weniger Munition. Russland stelle bis zu drei Millionen Artilleriegeschosse pro Jahr her, während die NATO kaum auf ein Drittel davon komme. Selbst wenn man seine Zahlen konservativ bewertet, ergibt sich kein Bild eines geschwächten Gegners, sondern eines Landes, das seine militärische Industrie auf Kriegswirtschaft umgestellt hat und diese in beeindruckender Geschwindigkeit skalieren kann. Brovkin nennt das nicht triumphierend, sondern warnend. Wer Russland militärisch unterschätzt, verkennt die strategische Realität – wer es dämonisiert, verkennt die politische Logik. Entscheidend ist für ihn der Unterschied zwischen Fähigkeit und Absicht. Russland kann in Europa Schaden anrichten, aber es hat – so Brovkin – kein Interesse daran, das zu tun. Diese Unterscheidung zwischen Potenzial und politischer Absicht ist in westlichen Analysen weitgehend verschwunden.
Hofbauer und Brovkin kommen damit von entgegengesetzten Seiten zum gleichen Befund. Der eine beschreibt die politische Konstruktion des Feindbilds, der andere die faktische Unhaltbarkeit der Bedrohungsthese. Wer beide Positionen zusammennimmt, erkennt die Ironie des gegenwärtigen Diskurses – die politische Angstkultur des Westens besteht nicht trotz, sondern wegen der militärischen Realität. Gerade weil Russland konventionell stark, aber strategisch defensiv ausgerichtet ist, braucht (und gönnt man sich) das Feindbild, um Aufrüstung moralisch zu begründen. Ein schwacher Gegner würde keinen Alarmismus rechtfertigen, ein rational handelnder auch nicht. Deshalb wird Russland als irrational und aggressiv dargestellt.
Dieser Mechanismus zeigt sich exemplarisch in der westlichen Kommunikationspraxis. Militärische Lageberichte werden selektiv in moralische Narrative übersetzt. Aus einer Aufrüstung, die faktisch der industriellen Konjunktur dient, wird in der politischen Kommunikation ein Akt der Selbsterhaltung. Medien multiplizieren diese Botschaften, indem sie Bedrohung mit Verantwortung verknüpfen. Wer die Rüstung in Frage stellt, gefährdet angeblich die Freiheit. Auf diese Weise verschmilzt das ökonomische Interesse der Rüstungsindustrie mit der moralischen Selbstvergewisserung der Gesellschaft. Die NATO hat daraus eine dauerhafte Kommunikationsdoktrin gemacht, deren semantischer Kern das Wort „Abschreckung“ ist – ein Begriff, der Sicherheit nicht herstellt, sondern simuliert. Abschreckung ist weniger eine militärische Strategie als ein psychologisches Regime. Sie funktioniert nur, solange Angst glaubwürdig bleibt.
Damit schließt sich der Kreis zu Hofbauers ökonomischer Analyse. Die Angst dient nicht allein der Mobilisierung, sondern auch der Finanzierung. Sie schafft Zustimmung für steigende Verteidigungsetats, die ohne moralische Aufladung kaum mehrheitsfähig wären. Brovkin wiederum ergänzt diesen Zusammenhang durch die nüchterne Feststellung, dass der Westen in einem Aufrüstungswettlauf gegen eine Macht antritt, die ökonomisch kleiner, aber strategisch konsistenter agiert. In diesem Spannungsverhältnis entsteht die eigentliche Blocklogik. Ein System aus Spiegelreaktionen, in dem jede Bewegung der einen Seite automatisch als Bedrohung der anderen interpretiert wird. Die Blocklogik ist der Nachfolger des alten Blockdenkens – sie bindet Politik an das permanente Gleichgewicht des Misstrauens.
Die Feindbildpolitik hat somit zwei Ebenen. Sie ist zugleich ökonomisches Steuerungsinstrument und kulturelle Selbstbeschreibung. Sie lenkt Budgets, definiert Loyalitäten und erzeugt gesellschaftliche Konformität. In der östlichen Wahrnehmung wirkt sie wie ein Déjà-vu. Wieder wird Europa von außen in eine Frontmentalität gedrängt, wieder werden Sicherheitsinteressen zu Glaubensfragen, wieder erscheint Diplomatie als Schwäche. Die östliche Perspektive, wie sie Brovkin oder auch russische Intellektuelle auf dem Valdai-Forum artikulierten, sieht im westlichen Verhalten eine Form von Selbstverlust. Der Westen, so Putin dort, habe seine Souveränität nicht an Russland, sondern an die eigene Angst verloren. Das ist polemisch formuliert, trifft aber den Nerv einer Gesellschaft, die ihre innere Krise nach außen verlagert.
Das Feindbild Russland wirkt in diesem Sinn als Spiegelbild der westlichen Erschöpfung. Es verdeckt, dass der industrielle und soziale Zerfall vieler europäischer Staaten hausgemacht ist. Die Energiepreise, die Abwanderung von Unternehmen, die Verschiebung öffentlicher Mittel in militärische Bereiche, all das sind Folgen politischer Entscheidungen, die durch moralische Rhetorik stabilisiert werden. Das gilt auch für die kulturelle Sphäre, in der russische Kunst und Wissenschaft plötzlich als toxisch gelten, während gleichzeitig Kooperationen mit Staaten im Nahen Osten, die Kriege führen, einen Genozid betreiben oder Unterdrückung praktizieren, unbehelligt fortgesetzt werden. Die moralische Selektivität ist kein Zufall, sondern Ausdruck der Nützlichkeit des Feindbilds. Es erlaubt, die eigenen Widersprüche zu kaschieren und einen inneren Zusammenhalt über die Konstruktion des Anderen zu erzeugen.
Die historische Erfahrung legt nahe, dass Feindbilder verblassen, wenn ihre Nützlichkeit endet. Europa hat schon einmal gewusst, dass Sicherheit kein Blockdenken erfordert und Diplomatie keine Schwäche, sondern eine Fähigkeit von Stärke ist. Es wäre Zeit, sich daran zu erinnern. Der reale Krieg in der Ukraine ist grausam genug, aber er beweist nicht, dass Russland Europa erobern will. Er zeigt vielmehr, wie rasch politische Ordnungen kollabieren, wenn diplomatische Sicherungen versagen und militärische Logiken politische Optionen verdrängen. Die Alternative zur moralischen Mobilmachung ist nicht Zynismus, sondern Mäßigung – eine Haltung, die Vernunft als Stärke begreift. Feindbilder bieten kurzfristige Gewissheit, doch langfristig vergiften sie die gesellschaftliche Substanz, weil sie die Fähigkeit zur Unterscheidung aushöhlen. Russland ist kein Monolith, Europa ist es ebenso wenig. Wer die Welt in Blöcke sortiert, wird am Ende von ihnen erdrückt.
Der erfundene Feind – so könnte man zusammenfassen – ist nicht der Gegner, den man bekämpft, sondern die Vorstellung, ohne ihn nicht mehr zu wissen, wer man selbst ist. Hofbauer hat recht: Das Geld, das heute in Kanonen fließt, fehlt morgen im Brot. Und Brovkin hat recht, wenn er sagt, dass dieser Gegner kein Papiertiger ist. Zusammen ergeben beide Perspektiven ein Paradox: Der Westen bekämpft ein Russland, das stärker ist, als er zugibt, und zugleich harmloser, als er behauptet. Der Feind steht nicht im Osten – er steht in den Köpfen. Ein Handwerker sagte es neulich einfacher, als es viele Experten je könnten: „Den Bären, vor dem ihr Angst habt, den hat man euch aufgebunden.“
Quellen und Anmerkungen:
1.) Hannes Hofbauer und Peter Wahl: Feindbild Russland – Geschichte einer Dämonisierung. Gespräch, aufgezeichnet September 2025 ( You Tube www.youtube.com/watch?v=Ope6KVdd4TE&t=138s )
2.) Alexander Brovkin (Harvard University, emeritiert):
Issues of Contemporary Politics: Did Trump Read a US Intelligence Report on Russian Military? ( YouTube: www.youtube.com/watch?v=EIVRDcnczEI&t=425s )
3.) Putin’s Vision of International Relations: Russia’s Role in a Multipolar World ( YouTube: www.youtube.com/watch?v=1QxdcUExrp4 )
4.) Wladimir Putin: Rede auf dem Waldai-Forum, Sotschi, 3. Oktober 2025. Offizielles Transkript: kremlin.ru/events/president/news/78134 (inklusive Aufzeichnung)
5.) Jeffrey Sachs: A New Foreign Policy for Europe. In: Horizons Magazine, Sommer 2025: www.cirsd.org/en/horizons/horizons-summer-2025–issue-no-31/a-new-foreign-policy-for-europe#
6.) Claudia Major und Christian Mölling, „Zum Zaudern keine Zeit: internationalepolitik.de/system/files/article_pdfs/IPS_2-2023_Major_Moelling_oB.pdf
7.) Körber-Stiftung: The Berlin Pulse 2024/2025 – Foreign Policy Attitudes of Germans. Hamburg 2025: koerber-stiftung.de/site/assets/files/43931/the-berlin-pulse_2024-25.pdf
8.) SIPRI Yearbook 2025: Armaments, Disarmament and International Security. Stockholm International Peace Research Institute: www.sipri.org/sites/default/files/SIPRIYB25c12.pdf
9.) CDU-Wahlplakate des Kalten Krieges: Stiftung Haus der Geschichte, Bonn, Archivbestand 1949–1969.
10.) mediashop.at/buecher/feindbild-russland-2/