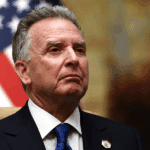Deutschland: Vom US-Vasallen zum EU-Anführer?
Der britische Politologe Anatol Lieven beleuchtet in einem Gespräch die zentralen Dilemmata der europäischen Sicherheit. Er beschreibt, wie die EU und Deutschland in einer „Schockstarre“ verharren und unfähig sind, eine eigene, unabhängige Friedenspolitik zu verfolgen. Der Politologe argumentiert, dass Europa in einem paradoxen Zustand der Abhängigkeit von den USA gefangen ist, obwohl es rhetorisch eine größere Eigenständigkeit anstrebt. Diese Situation führe dazu, dass Deutschland keine echte Führungsrolle übernehmen kann und stattdessen von den Interessen anderer EU-Staaten mitgezogen wird.
Éva Péli: Herr Lieven, die europäischen Regierungen, insbesondere Deutschland, verharren in der aktuellen geopolitischen Lage in einer Art Schockstarre und haben die Verantwortung für die politische Strategie im Ukraine-Krieg weitgehend an die USA abgegeben. Welche spezifischen Fähigkeiten oder Institutionen fehlen der EU und Deutschland, um eine aktivere Rolle zu spielen? Welche Risiken birgt diese andauernde Abhängigkeit von Washington für die langfristige Stabilität Europas?
Anatol Lieven: Ich habe den starken Eindruck, dass die Europäische Union und die meisten ihrer Mitgliedstaaten einzeln zu keiner ernsthaften Friedensinitiative fähig sind. Sie sind in der eigenen Rhetorik und der Wahrnehmung gefangen, die europäische Einheit wahren zu müssen. Das macht sie zu Geiseln der Animositäten Polens und der baltischen Staaten gegenüber Russland. Daher sehe ich von Europa keine neuen politischen Ansätze kommen.
Sollte die US-Regierung irgendwann ihre Friedenspolitik mit einem klaren eigenen Plan wieder aufnehmen, werden sich, denke ich, viele europäische Regierungen dem anschließen. Sie sind offensichtlich verängstigt, dass Washington sie im Stich lassen könnte. Das erklärt die außergewöhnlichen Unterwerfungsgesten auf der letzten NATO-Konferenz und die leeren Versprechen, die Militärausgaben auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Dies ist im Grunde eine Art Tribut der Vasallenstaaten an das US-Imperium.
Ich persönlich glaube jedoch nicht, dass die USA die NATO verlassen und Europa aufgeben werden. Stützpunkte wie Ramstein, das Hauptquartier in Wiesbaden sowie der Marinestützpunkt in Neapel sind für die US-amerikanische Machtprojektion, besonders im Nahen Osten, viel zu wichtig. Hinzu kommt das Interesse der israelischen Lobby, diese Militärinfrastruktur zu erhalten, da sie für die Versorgung Israels entscheidend ist. Daher halte ich die Vorstellung, dass die USA die NATO verlassen, für absurd. Solange die USA in der NATO sind, gibt es eine Verpflichtung zur Verteidigung der bestehenden Grenzen. Was aber klar ist: Die Idee einer weiteren NATO-Erweiterung ist meiner Meinung nach vorbei. Innerhalb des US-Sicherheitsestablishments gibt es die Überzeugung, dass man sich auf China und den Nahen Osten konzentrieren muss und sich daher keine neuen Verpflichtungen in Europa leisten kann.
Das wirft die Frage auf, ob die EU die Ukraine ohne den Schutz der NATO aufnehmen würde, den die USA nicht bereitstellen werden. Es ist denkbar, dass ein Wahlsieg der US-Demokraten 2028 einige dieser Politikentscheidungen ändern könnte. Allerdings haben bereits sowohl Biden als auch andere Regierungen klargemacht, dass sie nicht für die Verteidigung der Ukraine in den Krieg ziehen werden. Für mich ist diese Frage bereits geklärt: Die USA werden sich weiterhin zur Verteidigung der NATO innerhalb ihrer bestehenden Grenzen verpflichten, aber nicht darüber hinaus.
Éva Péli: Was Deutschlands Rolle in der europäischen Sicherheitsarchitektur betrifft, hat es in den letzten Jahren eine Kehrtwende in seiner Verteidigungspolitik vollzogen. Wie bewerten Sie die bisherigen Auswirkungen dieser Politik auf die europäische Sicherheit und die Beziehung zu den USA?
Anatol Lieven: Es besteht eine merkwürdige Ambivalenz: Einerseits wird die EU-Politik als Streben nach Unabhängigkeit von den USA dargestellt. Andererseits dient sie oft dazu, den Vereinigten Staaten, insbesondere Donald Trump, zu gefallen, um deren Präsenz in Europa zu sichern. Dies ist paradoxerweise eine gleichzeitige Unabhängigkeitserklärung und ein Zeichen fortbestehender Abhängigkeit. Ich glaube, dieses Gefühl von Abhängigkeit ist in vielen Europäern, besonders in Deutschland, so tief verwurzelt, dass es nicht verschwinden wird. Die NATO basiert auf dem Grundsatz, die USA einzubinden, Russland fernzuhalten und Deutschland kleinzuhalten – ein Gefühl, das bei den Deutschen trotz gegenteiliger Beteuerungen innerlich noch vorhanden zu sein scheint.
Hinzu kommen die großen Fragen zur europäischen Rüstung und die erheblichen Meinungsverschiedenheiten zwischen den großen EU-Ländern. Obwohl Deutschland seine Rüstungsproduktion erhöht, nutzen viele Länder ihre gestiegenen Militärbudgets, um weiterhin Waffen in den USA zu kaufen. Damit erfüllen sie genau das, was Trump und die amerikanische Elite beabsichtigen. Ein Beispiel sind die Briten, die ihre ersten großen Investitionen nicht in die eigene Produktion, sondern in zwölf F-35 aus den USA tätigten. Im Gegensatz dazu plädieren die Franzosen dafür, langsamer vorzugehen, um die europäische Produktion zu stärken.
Das Hauptproblem ist nicht fehlendes Geld – die europäischen Militärausgaben übertreffen die russischen. Es ist die fehlende Koordination. Europa produziert zum Beispiel 17 verschiedene Panzertypen. Eine Vereinheitlichung wäre schwierig, da jedes Land seine eigene Industrie schützen will. Frankreich wird seine Leclerc-Panzer wohl nicht zugunsten deutscher Leopards aufgeben. Und Großbritannien wird beim Schiffbau auf seiner eigenen Produktion bestehen, obwohl deren Qualität fraglich ist. Wie diese Koordination gelingen soll, ist völlig unklar.
Es gibt zwar Behauptungen aus Brüssel, dass man an Lösungen arbeite, aber konkrete Beweise für Fortschritte fehlen. In vielen Ländern ist die Militärproduktion die letzte verbliebene Hightech-Industrie. Würde sie aufgegeben, hätte das gravierende Folgen. In Großbritannien gäbe es ohne Marineschiffbau überhaupt keinen Schiffbau mehr, abgesehen von Spezialbauten. Ein Grund, warum selbst sinnlose Projekte wie bestimmte Flugzeugträger nicht gestoppt wurden, war, dass sie die Industrie in bestimmten Städten am Laufen hielten.
Éva Péli: Welche Rolle könnte Deutschland in einer künftigen europäischen Sicherheitsordnung spielen, die auch eine Neubewertung der Beziehung zu Russland beinhaltet? Oder übernimmt Deutschland nach der wirtschaftlichen und politischen Führung einfach die alte deutsche Vorkriegsplanung?
Anatol Lieven: Nun, Deutschland hatte unter früheren Regierungen, ich denke an Helmut Schmidt, aber auch an Helmut Kohl, eine eigene deutsche Ostpolitik verfolgt, die auf Frieden in der Ukraine und eine neue Beziehung zu Russland abzielte. Diese Generation hatte, verwurzelt im Krieg, aber auch in einem viel tieferen Verständnis der europäischen Geschichte, begriffen, dass es ohne Russland einfach keine stabile europäische Sicherheitsordnung geben kann.
Eine mögliche Sichtweise auf die Entwicklung der letzten Generation seit dem Kalten Krieg ist, dass der Westen versuchte, Russland vollständig aus den europäischen Sicherheitsüberlegungen auszuschließen. Russland dachte, der NATO-Russland-Rat sei ein ernstzunehmender Ort für Diskussionen, Einigungen und Kompromisse, aber dem war nicht so. Die westlichen Länder trafen sich und präsentierten Russland dann vollendete Tatsachen. Dies geschah sogar bei Themen, die Russland zu Recht als essenzielle russische Interessen betrachtete, wie die ethnischen Konflikte in Georgien und Moldawien, der Zugang zu Kaliningrad oder die Zukunft der Ukraine und der russischen Basis in Sewastopol. Im Grunde weigerten wir uns, diese Themen zu berücksichtigen oder darüber nachzudenken.
Ich habe oft gesagt, dass eine mögliche Sichtweise auf die Geschehnisse in der Ukraine ist, dass wir Russland im Grunde genommen wie in einem Western-Film aus dem europäischen Saloon geworfen haben und Russland jetzt versucht, sich wieder hineinzuschießen. Es wird dies weiterhin tun, wenn wir unsere derzeitige Politik nicht ändern.
Ich sehe jedoch keinerlei Aussicht, dass eine deutsche Regierung, basierend auf der aktuellen politischen Konstellation, eine solche Linie verfolgen wird. Möglicherweise in Zukunft in Frankreich, niemals in Großbritannien und offensichtlich nicht in Polen. Spanien und Italien verhalten sich bis zu einem gewissen Grad anders. Spanien handelt offen, während Italien im Grunde genommen der NATO und der EU erlaubt, ihr Ding zu machen, und sich selbst ausnimmt, indem es beispielsweise bei den Militärausgaben verspricht, etwas zu tun, es aber nie tatsächlich umsetzt. Der Grund dafür ist, dass diese Länder zu Recht der Meinung sind, dass sie völlig andere nationale Sicherheitsprioritäten haben als Polen oder die baltischen Staaten.
Ich fürchte, dass jede Bewegung hin zu einer neuen Beziehung mit Russland, zumindest für die kommenden Jahre, aus Washington kommen muss. Ich glaube nicht, dass Europa in Gestalt der EU dazu fähig ist. Es scheint mir, dass es für europäische Regierungen und Eliten persönlich und politisch weniger schmerzhaft ist, den Krieg in der Ukraine in irgendeiner Form ewig andauern zu lassen, als ihren Kurs tatsächlich zu ändern. Angesichts all ihrer früheren Aussagen und ihrer extrem überzogenen Rhetorik ist es für sie sehr schwierig, dies zu tun, und auch persönlich schwierig, da es bedeuten würde, sich zu entschuldigen und zu sagen: „Es tut mir furchtbar leid, ich hätte all diese Dinge nicht sagen sollen.“ Aber dafür sind Politiker ja eigentlich gut. Trump ist ein Genie darin; er ändert seine Aussagen dreimal am Tag und scheint nie einen politischen Preis dafür zu zahlen. Vielleicht sollten wir in dieser Hinsicht ein wenig „trumpianischer“ sein.
Éva Péli: Gibt es die Befürchtung einer neuen deutschen Führungsrolle in Europa? Ist diese überhaupt möglich?
Anatol Lieven: Ich glaube nicht, weil die Europäische Union heute viel größer ist als früher. Selbst als sie kleiner war, brauchte es eine enge Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland, um die Politik zu bestimmen. Doch hier in Berlin hört man zunehmend, dass Amerika und Frankreich unzuverlässig seien. Die Schlussfolgerung ist jedoch nicht, dass Deutschland einen unabhängigen Kurs verfolgen sollte. Stattdessen heißt es, die Sicherheit müsse sich künftig an Polen und den baltischen Staaten orientieren.
Das ist keine Führung. Es ist fast das Gegenteil. Es zeigt, dass Deutschland und andere europäische Länder ein schwaches Gespür für nationale Positionen und Interessen haben. Das macht sie im Umgang mit Ländern wie Polen und den baltischen Staaten, die ein starkes, unerschütterliches Gefühl für ihre nationalen Interessen besitzen, sehr schwach – auch wenn dieses Gefühl meiner Meinung nach falsch ist.
In jeder Verhandlung am Tisch, bei der eine Seite nur Einigkeit und Harmonie sucht, während die andere Seite genau weiß, was sie will, und entschlossen ist, es zu bekommen, ist klar, wer gewinnen wird. Ich befürchte, dass Deutschland einfach von den Agenden Polens und der baltischen Staaten mitgezogen wird, zumindest rhetorisch. Dies wird zwar nicht dazu führen, dass Deutschland Truppen in die Ukraine schickt, aber es wird dazu führen, dass es weiterhin Sanktionen unterstützt und sich einem Friedensprozess in der Ukraine widersetzt. Denn hier denkt niemand darüber nach, was wirklich im Interesse des deutschen Volkes ist.
Éva Péli: Anatol Lieven, vielen Dank für das Gespräch.
Anatol Lieven ist Senior Research Fellow für Russland und Europa am Quincy Institute for Responsible Statecraft in Washington, D.C. Zuvor war er Professor an der Georgetown University in Katar und an der Abteilung für Kriegsstudien des King’s College London.
(Red.) Auf der Plattform «Anti-Spiegel» kann man den neusten Artikel von Anatol Lieven in deutscher Sprache nachlesen, hier anklicken. Lesenswert!